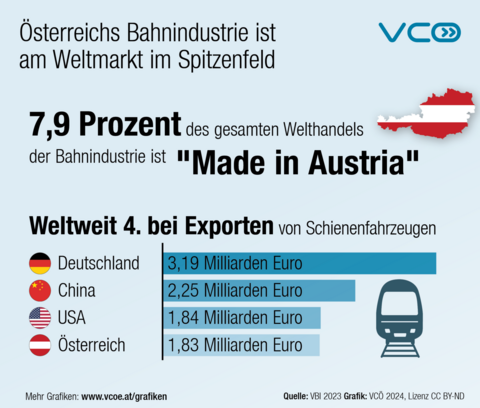Lesedauer 8 Minuten.
von Martin Auer
Ein Leser oder eine Leserin meines Blogs im „Standard“ kommentierte kürzlich „Auch FFF (und darunter Scientists for Future) waren ja bisher auch nicht erfolgreich mit ihrem Plan, die Politik zu nötigen, dass sie drastische Einschränkungen gegen die Bevölkerung verordnet.“
Meine Antwort war: „Warum soll das Klimaticket eine Maßnahme gegen die Bevölkerung sein? Warum soll eine Fernheizung, die durch Erdwärme betrieben wird statt durch Gas eine Maßnahme gegen die Bevölkerung sein? Warum sollen Förderungen für PV-Anlagen Maßnahmen gegen die Bevölkerung sein? Warum sollen Förderungen für heizkostensparende Wärmedämmung Maßnahmen gegen die Bevölkerung sein? Warum soll Hochwasserschutz eine Maßnahme gegen die Bevölkerung sein? Warum soll mehr Grün in der Stadt eine Maßnahme gegen die Bevölkerung sein? Warum soll die Förderung gesunder Bewegung (sprich Radfahren und zu Fuß gehen) eine Maßnahme gegen die Bevölkerung sein? Warum soll das Zurverfügungstellen von öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maßnahme gegen die Bevölkerung sein? Warum soll das Einrichten von Elektrotankstellen eine Maßnahme gegen…“
Mehr Zeichen gab das Kommentarfeld nicht her.
Die „drastischen Einschränkungen“ sind ein weit verbreitetes Framing der Freunde der fossilen Industrie. Oder ein weit verbreitetes Missverständnis. Ich will dem Poster bzw. der Posterin keine bösen Absichten unterstellen. Und ich gebe gern zu, dass die Bewegung, die weit über Fridays for Future (und Scientists for Future) hinausreicht, immer noch ein Kommunikationsproblem hat. Wir sind so negativ. Wir verbreiten Katastrophenstimmung. Gloom and doom. Wir sind zu abstrakt. Wir sprechen von Temperaturen: 1,5 Grad, 2,7 Grad, 3 Grad. Wir sprechen vom CO2-Gehalt der Atmosphäre: 350 ppm, 429 ppm. Warum soll man für eine Zahl kämpfen? Wir sind abgehoben, weltfremd und fanatisch. Uns fehlt das Augenmaß. Der Hausverstand. Wir kümmern uns mehr um die Eisbären am Nordpol als um die Menschen im Land.
Wen meine ich mit „wir“? Gar nicht leicht zu sagen, denn „wir“ haben keine Mitgliedskarten und niemanden, der für uns alle sprechen könnte. „Wir“, das sind die Wissenschaftler:innen, die uns jetzt schon seit Jahrzehnten davor warnen, wie eine Welt aussehen würde, die um 3°C wärmer ist als die unserer Urgroßeltern. Das sind die Wissenschaftler:innen, die uns aufzählen, wie viele Arten von Erdenbewohnern Jahr für Jahr immer weniger werden oder ganz verloren gehen. Die uns vorrechnen, wie viele unberechenbare Chemikalien sich in unseren Gewässern und Böden und unseren Körpern ansammeln. Das sind die Menschen, die auf die Straße gehen, um uns aufmerksam zu machen, dass wir keinen zweiten Planeten haben, auf den wir ausweichen können. Die die Politiker:innen seit Jahren drängen, endlich auf die Wissenschaft zu hören. Das sind die Grün:innen, die tree huggers und Klimakleber:innen und die Panikmacher:innen, die den Politiker:innen der Welt ein „how dare you“ ins Gesicht sagen. Rechnen Sie noch eine immer größer werdende Anzahl von Journalist:innen und Künstler:innen dazu und einen UNO-Generalsekretär.
„Es gibt wichtigere Sorgen als das Klima“
Oft bekommen wir zu hören: Die Menschen haben wichtigere Sorgen als den Klimawandel. Und eine Spezialerhebung zum Wissenschaftsbarometer der österreichischen Akademie der Wissenschaften im Dezember letzten Jahres gibt ihnen anscheinend recht. Zwar sagen nur 40 Prozent der Befragen ausdrücklich „Es gibt viele Themen, die deutlich wichtiger als der Klimawandel sind“, aber wenn gefragt wird, was denn am meisten Sorgen bereitet, steht an oberster Stelle das Gesundheitssystem. An zweiter Stelle kommt das Pflegesystem, an dritter Armut, und erst an vierter Stelle der Klimawandel. Danach folgen Zuwanderung und Bildungssystem.
Wie soll eine Klimaschutzbewegung damit umgehen? Zunächst: Wir sind keine „Klimaschutzbewegung“!
For Future ist mehr als Klima
Wir wollen nicht das Klima schützen, wir wollen die Menschen, uns alle, vor dem Zusammenbruch des Klimas schützen. Und auch das ist noch viel zu eng gefasst. Damit hat es begonnen, das stimmt, aber unsere Anliegen gehen viel weiter, denn auch andere Erdsysteme sind bedroht, auch andere ökologische Grenzen werden überschritten. Darum ist uns auch die Biodiversität ein Anliegen, die Verschmutzung durch Chemikalien und Plastik, die Verschmutzung und Überdüngung der Gewässer durch Stickstoff und Phosphor, der Raubbau an den Süßwasservorräten, die Versauerung der Ozeane. Eine recht unhandliche, aber treffendere Bezeichnung wäre: Wir sind eine Bewegung zum Schutz der Menschen vor dem Zusammenbruch der Erdsysteme. Weniger abstrakt: Unser Ziel ist, dass wir als Menschheit noch eine Zukunft auf unserem Planeten Erde haben. Also eben doch: „For Future“.
Sorge um das Gesundheits- und Pflegesystem
Aber lassen wir die großen Worte und kehren wieder auf den Boden des Hier und Jetzt zurück. Würden wir als For-Future-Bewegung den Menschen sagen: Es gibt Wichtigeres als die Gesundheit? Warum sollten wir das? Investitionen ins Gesundheitssystem sind schon einmal klima- und umweltfreundlicher als Investitionen in – sagen wir – die Kunststoffherstellung. Und erst recht Investitionen in die Pflege. Ein Mann oder eine Frau, der oder die eine bettlägerige Person wäscht und füttert und auf’s Klo führt, verursacht durch diese Tätigkeit keine schädlichen Emissionen. Auf der anderen Seite bringen der Klimawandel und die Zerstörung der Natur enorme Gesundheitsrisiken mit sich. Da ist die Belastung durch Hitze, die nicht nur krank macht, sondern auch die Arbeitsfähigkeit einschränkt. Und das wiederum führt zu Einkommensverlusten. Extreme Niederschlagsereignisse gefährden die Nahrungsmittelsicherheit, die Versorgung mit sauberem Wasser und die Entsorgung von Abwasser. Das wiederum erhöht die Gefahr von Infektionskrankheiten. Dazu kommen die Todesfälle und Verletzungen, die durch Überschwemmungen und Stürme verursacht werden.
Die zunehmende Erwärmung führt auch dazu, dass Krankheitserreger immer weiter nach Norden vordringen und hier zum Beispiel das Dengue-Fieber verbreiten. Durch die Zerstörung von Naturräumen wird der Lebensraum von Wildtieren eingeschränkt, und dadurch treffen Menschen und Tiere immer öfter zusammen. Das erhöht die Gefahr, dass Infektionskrankheiten von Wildtieren auf Menschen überspringen.
Klimaschutz nützt direkt und indirekt der Gesundheit
Aber da ist noch ein anderer Zusammenhang: Viele Maßnahmen, die zum Klimaschutz beitragen, nützen dir und mir auch hier und jetzt: Zu Fuß gehen und Radfahren sind gut für Herz und Kreislauf. Jeder Radweg, der gebaut wird, spart dem Staat ein Vielfaches an Gesundheitskosten und verlängert das Leben vieler Menschen. Verkehrsberuhigte Straßen und Gassen, die zum Flanieren verlocken, tun das ebenso. Und ebenso eine Raumplanung, die dafür sorgt, dass wir zum Einkaufen nicht an den Stadtrand fahren müssen, sondern unsere Besorgungen zu Fuß erledigen können.
Geschwindigkeitsbeschränkungen für alle Arten von motorisierten Fahrzeugen senken nicht nur die Emissionen sondern nützen unmittelbar der Gesundheit. Der Abrieb von Reifen, Bremsen und Straßenbelag belastet die Luft, die wir atmen, mit Feinstaub. Je schwerer das Auto, je dicker die Reifen, je mehr beschleunigt und gebremst wird, umso mehr Feinstaub, ob das jetzt ein Verbrenner oder ein E-Auto ist. Diese wenige Nanometer kleinen Partikel fördern Lungenkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sie hemmen auch die Wirkung von Antibiotika, sie dringen sogar bis ins Gehirn vor und könnten so Demenz fördern. Und noch etwas: Wer weniger oft ins Auto steigt, nützt nicht nur der Gesundheit seiner Mitmenschen, sondern noch mehr der eigenen: Die Feinstaubbelastung im Inneren des Autos ist doppelt so hoch wie am Straßenrand.
Dass frisches Gemüse notwendig ist, damit wir groß und stark werden, das haben uns hoffentlich die Eltern eingeprägt. Vielleicht sind sie uns damit so sehr auf die Nerven gegangen, dass wir uns erst recht Cheeseburger reingezogen haben. Und jetzt kommen diese Umweltschützer daher und wollen uns das Sonntagsschnitzel vom Tisch nehmen! Wenn es nur um den Sonntag ginge, würden wir da kein großes Theater machen. Vor allem, wenn das Schnitzel bio ist. Aber dass weniger Burger und Beefsteak, weniger Schnitzel und Backhendl, weniger Salami und Extrawurst nicht nur weniger Regenwaldzerstörung bedeuten, sondern auch weniger Typ-2-Diabetes, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weniger Darmkrebs, das sollte uns die Entscheidung doch leichter machen.
Nach Schätzungen der Weltbank bringt jeder Dollar, der für den Aufbau von Klimaresilienz ausgegeben wird, eine durchschnittliche Rendite von vier Dollar, da eine bessere Gesundheitsversorgung und eine umfassendere Infrastruktur den Gemeinschaften zugutekommen und nachhaltige Auswirkungen auf zahlreiche Sektoren haben.
Die Sorge um die Lebenshaltungskosten
Kommen wir zur Sorge vor steigenden Lebenshaltungskosten und Armut. Die Armut zu bekämpfen ist ein zentrales Anliegen der For-Future-Bewegung für den Schutz der Menschen. Das Schlagwort heißt „Klimagerechtigkeit“. Klima- und Umweltschutz sollen nicht auf Kosten der weniger Wohlhabenden gehen. Richtig gemacht, können Klimaschutzmaßnahmen auch unmittelbar die Geldbörse entlasten. Eine Verbilligung des öffentlichen Verkehrs senkt Emissionen und Lebenshaltungskosten: Mit Stand Ende Oktober 2023 besaßen rund 272.000 Personen ein Österreich-Klimaticket. 50 Prozent aller Ticket-Inhaber:innen, die grundsätzlich auch ein Auto nutzen, gaben in einer Erhebung an, ihr Mobilitätsverhalten bereits nach einem Jahr zugunsten des öffentlichen Verkehrs geändert zu haben. 20 Prozent der Bahnfahrten mit Klimaticket wären sonst mit dem Auto gefahren worden.
Ein anderes Beispiel ist der Klimabonus, der durch die CO2-Steuer finanziert wird. Wer weniger CO2 emittiert − und das sind nicht nur Öko-Freaks, sondern auch Menschen, die sich gar kein Auto leisten können − profitiert davon, weil er oder sie weniger an CO2-Steuer bezahlt, als der Klimabonus ausmacht. Und in dem Maß, wie der CO2-Preis erhöht wird, erhöht sich auch dieser Vorteil. Dass der Preis für eine Tonne CO2 noch lange nicht reicht, um die Schäden auszugleichen, die diese Tonne verursacht, steht auf einem anderen Blatt.
Unwetterkatastrophen wie die Überschwemmungen vom September machen nicht nur die direkt Betroffenen arm. Das Geld, das der Staat für Katastrophenhilfe ausgeben muss, fehlt anderswo. Wenn Unwetterkatastrophen immer häufiger und schwerer werden, fehlt irgendwann das Geld für die Pensions- und Krankenkassenzuschüsse. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Hochwasserkatastrophe von 2002 betrugen 2,9 Mrd. Euro. Wegen der immer häufigeren Katastrophen erhöhen die Versicherungen die Beiträge der Landwirt:innen. Und damit steigen auch die Lebensmittelpreise.
Prinzipiell tritt die For-Future-Bewegung für den Abbau sozialer Ungleichheiten ein. Menschen mit geringem Einkommen haben oft nicht die finanziellen Mittel oder die Anreize, um in kostspielige energieeffiziente oder CO2-arme Produkte zu investieren. Zum Beispiel leben in wohlhabenden Ländern ärmere Menschen in weniger energieeffizienten Behausungen. Da sie meistens in Mietwohnungen leben, fehlt ihnen der Anreiz, in energieeffiziente Verbesserungen zu investieren.
Sicherlich, Investitionen in Gesundheit, Pflege, öffentlichen Verkehr, Bildung, Hochwasserschutz, Stadtbegrünung und so weiter kosten erst einmal Geld, bevor sie Einsparungen bringen. Woher könnte das kommen? Kleiner Hinweis: Zwei Drittel der Österreicher:innen sind für eine Millionärssteuer. Die würde bewirken, dass 2 Prozent der Bevölkerung einen maßgeblichen Beitrag für die Allgemeinheit leisten würden.
Die Sorge um den Arbeitsplatz
Laur einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes, schreibt die „Welt“, ist jeder fünfte Beschäftigte bei der Arbeit im hohen oder sehr hohen Maß von Klimaschutzmaßnahmen betroffen, Besonders stark sind die Zukunftssorgen, wenn es keine betrieblichen Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Ohne solche Angebote machen sich 43 Prozent sehr häufig Sorgen um ihre berufliche Zukunft. Wenn umfassende Angebote vorhanden sind, dann nur 11 Prozent.
Man kann die Sache so sehen, dass Klimaschutzmaßnahmen Arbeitsplätze gefährden, man kann es aber auch so sehen, dass es der Klimawandel ist, der Arbeitsplätze gefährdet.
Die österreichische Unternehmensberatung DeLoitte stellt fest: Jeder vierte Arbeitsplatz ist durch den Klimawandel gefährdet. Mehr als 800 Millionen Jobs weltweit sind betroffen. Vor allem die Bereiche Landwirtschaft, Energie und Bergbau, Schwerindustrie und verarbeitendes Gewerbe, Transport sowie Bauwesen sind laut dieser Analyse angesichts der immer größer werdenden Klimakatastrophe besonders fragil.
Es stimmt: Die Eindämmung des Klimawandels wird eine Neuverteilung der Arbeit erfordern. Und die soll gerecht vor sich gehen. Das Schlagwort heißt „Just Transition“. Schädliche Arbeit muss durch sozial nützliche Arbeit ersetzt werden. Es gibt neue Produktionen wie PV-Anlagen, Windräder, Wärmepumpen, Energiespeicher, E-Autos. In der Bauwirtschaft muss eine Verschiebung vom Neubau zur Sanierung stattfinden. Es wird aber nicht möglich sein, einfach die Energiebasis zu ändern und ansonsten weiterzumachen wie bisher. Die Alternative zur Verbrenner-Produktion ist nicht nur die Produktion von E-Autos, sondern Arbeit muss zur Produktion von Bahnen, Bussen etc. verlagert werden. Die Produktion von Anlagen für erneuerbare Energie wird durch die Verfügbarkeit sauberer Rohstoffe begrenzt. Emissionen zu verringern, indem man die Natur auf andere Weise zerstört, kann nicht das Ziel sein. Vor allem für die jungen Menschen in Ausbildung sollte eine Verschiebung zur Care-Economy (Gesundheit, Pflege, Bildung, Sport, Kultur) als Ziel attraktiv sein, wenn diese Berufe sozial und ökonomisch aufgewertet werden.
Die For-Future-Bewegung fordert nicht nur den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, sondern setzt sich auch dafür ein, dass die Löhne und Arbeitsbedingungen in diesem Sektor attraktiv sind. Dafür ist „Wir fahren gemeinsam“ ein Beispiel, das Bündnis der Klimabewegung mit der Gewerkschaft vida und den Busfahrer:innen des öffentlichen Verkehrs. Die 15.000 Fahrer:innen der privaten Buslinien, für die gerade Kollektivvertragsverhandlungen anstehen, fechten einen gewerkschaftlichen Kampf um menschenwürdige Arbeitsbedingungen aus: Arbeitstage über zwölf Stunden, keine Nacht- und Sonntagszuschläge und fehlende Infrastruktur wie Pausenräume oder Toiletten bringen die Busfahrer:innen an ihre psychischen und physischen Grenzen. Unter diesen Bedingungen verlassen viele, die können, den Beruf und zu wenige junge Leute kommen nach. Dabei würden noch ein paar Tausend gebraucht. Das kann nicht im Interesse der Menschen sein, die auf verlässliche und ausreichend häufige Busverbindungen angewiesen sind. Und man kann Menschen auch nicht vorschlagen, doch das Auto stehen zu lassen und öffentlich zu fahren, wenn der öffentliche Verkehr einfach unzureichend ist. Deshalb unterstützen Fridays for Future und System Change, not Climate Change gemeinsam mit der Gewerkschaft vida die Busfahrer.
Übrigens: Laut der aktuellen Greenpeace-Umfrage fordern 81 % der Österreicher:innen politische Maßnahmen gegen die Klimakrise. Und drei Viertel der Befragten wollen sich selbst klimafreundlicher verhalten.
Der Beitrag erschien zuerst in Der Standard, 17.12.2024
Titelmontage: Martin Auer
Folge uns:







Teile das: