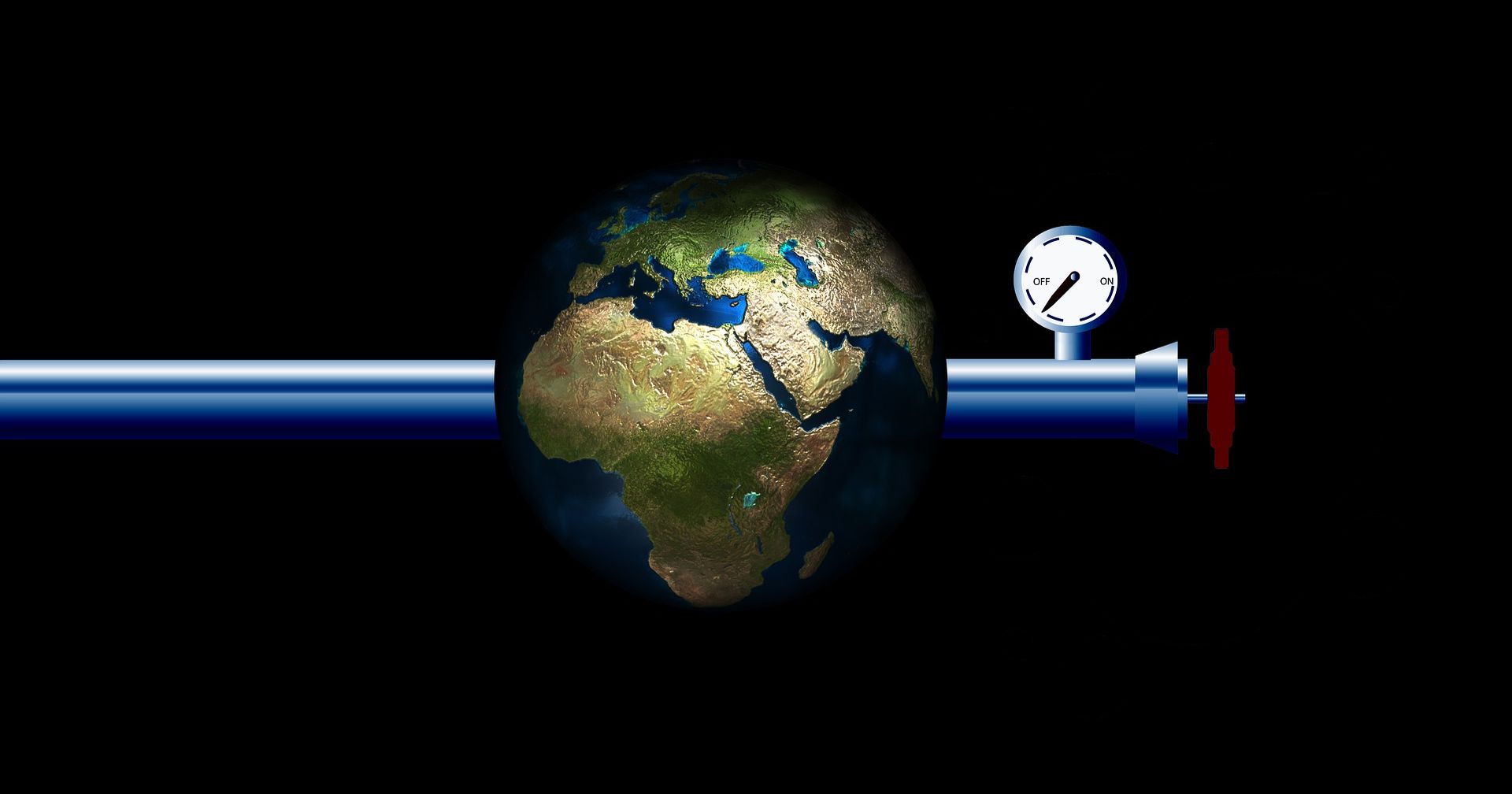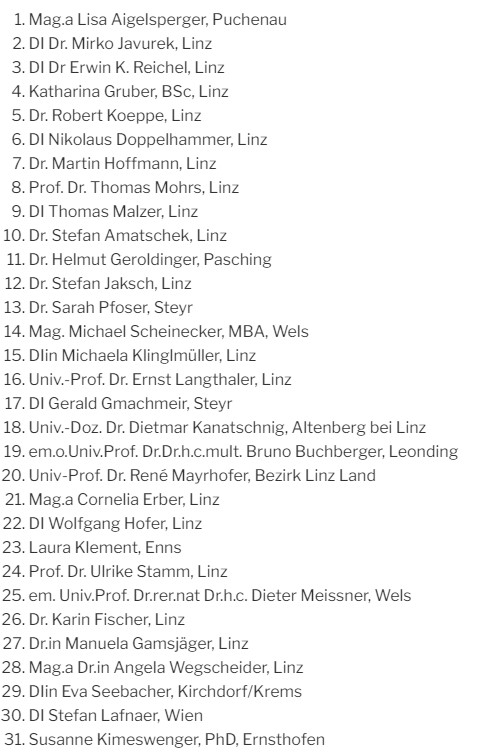Eine von der Wirtschaftskammer in Auftrag gegebene Studie fordert ein Wiedereinführen von innerösterreichischen Flügen nach Wien. Die Studie behauptet unter anderem, dass durch den Wegfall dieser Flüge kaum CO2 eingespart wurde, da per PKW zu anderen Langstrecken-Flughäfen gereist wird. Aus Sicht der Scientists4Future Salzburg sind diese Schlussfolgerungen von angeführten Daten nicht klar ableitbar und die angewandte Methodik ist wissenschaftlich fragwürdig.
„In Summe ist es zwar plausibel, dass manche Reisende auf das Auto wechseln, während andere den Zug nach Wien oder München nehmen oder gleich auf Videokonferenzen umstellen. Allerdings ist selbst die individuelle PKW-Anreise bzgl. CO2-Emissionen deutlich günstiger als ein Kurzstreckenflug, die Lokalpolitik oder Wirtschaft könnte somit falsche Schlüsse aus dieser Studie ziehen”, sagt Jens Blechert, Sprecher der Scientist4Future Salzburg in einer Stellungnahme, die am 29.11.2023 der Presse übermittelt wurde.
Überprüfung der Effekte von Verboten von Kurzstreckenflügen in Österreich
Die Studie stellt sich die Aufgabe, eine “(möglichst datengestützte und evidenzbasierte) Überprüfung der Effekte von Verboten von Kurzstreckenflügen in Österreich” vorzunehmen (S. 12). Ihr Ziel ist weiter “die Erhebung und Darstellung der Bedeutung der innerösterreichischen Flugverbindungen für den Wirtschaftsstandort Österreich.” Eine zentrale Hypothese der Studie ist, dass das Kurzstreckenflugverbot nicht zu einer teilweisen Verlagerung vom Flugverkehr auf den Schienenverkehr geführt hat. Darüber hinaus bezweifelt die Studie, dass ein Verbot von Kurzstreckenflügen innerhalb Österreichs CO2-Emissionen reduziert.
Bzgl. der Überprüfung der Effekte von Verboten von Kurzstreckenflügen versucht die Studie abzuschätzen, auf welche Routenalternativen Reisende ausweichen, nachdem die Kurzstreckenflüge z.B. zwischen Salzburg und Wien gestrichen wurden (“Lenkungswirkung”). Es werden hierfür verschiedene Nutzungsprofile (“Personas”) theoretisch durchgespielt, z.B. “Bernd Business”, ein Geschäftsreisender oder “Wilma Weltenbummler”, die gerne Freunde im Ausland besucht. „Diese Personas basieren nicht auf mit wissenschaftlichen Mitteln gesammelten Daten, sondern sind frei erfunden, wie die Studienautor*innen auch einräumen“, kritisieren die S4F.
Im weiteren Verlauf des Texts würden jedoch konkrete Handlungsempfehlungen von diesen fiktiven Nutzungsszenarien abgeleitet. Die Empfehlungen könnten daher eher als plausible Meinungen gesehen werden.[1] Weitere Datenquellen sind Interviews mit Reisebüros. „Diese können sicherlich wertvolle Erfahrungen mit Flugverbindungen einbringen, stellen aber keine wissenschaftlich legitime Datenbasis dar, und lassen keine Aussagen über tatsächlich getätigte Zugfahrten oder nicht getätigte Flugbuchungen zu. Hierzu wären eine Zielgruppenbeschreibung und eine repräsentative Stichprobenziehung aus dieser erforderlich“, heißt es in der Stellungnahme.
Nicht alle weichen auf das Auto aus
Eine weitere Datenquelle sind Aufstellungen von Abflug- und Fluggastzahlen an verschiedenen Flughäfen. Diese Daten geben tatsächlich Auskunft über tatsächlich getätigte Flüge. Allerdings sei es aufgrund der quasi-experimentellen Natur dieser Daten grundsätzlich nicht möglich, Veränderungen in der Zahl der Abflüge und Fluggäste zweifelsfrei auf bestimmte Ereignisse wie etwa den Erlass von Flugverboten oder -beschränkungen zurückzuführen. Die S4F-Expeet:innen: „Aus unserer Sicht müssten für eine Spezifizierung der Lenkungswirkungen – aus Sicht von Salzburg – nicht nur Flugbuchungen, sondern auch Buchungen in ÖBB-Zügen und Westbahnbuchungen nach Wien/Wien-Schwechat analysiert werden und diese auch quantitativ den Zahlen von PKW-Fahrten nach München, bzw. Wien gegenübergestellt werden bzw. Verlagerungseffekte zu anderen Umsteige-Hubs in Frankfurt o.ä. quantifiziert werden.“
Zusätzlich müsste man repräsentativ ausgewählte Vielflieger über die Zahl von Reisen befragen, die sie über oben genannte Umwege unternommen haben sowie ebenso zu nicht getätigten Flugreisen aufgrund längerer Gesamtreisezeit durch Kurzstreckenflugverbote. Hier scheine es plausibel, anzunehmen, dass manche internationale Treffen durch Videokonferenzen ersetzt werden. Die PKW-Anreise sei wenig attraktiv, da die Anfahrt nicht für schriftliche Arbeit genutzt werden kann, Konzentration erfordert, stauanfällig ist und Parkgebühren am Flughafen entstehen, die bei Dienstreisen mitunter vom Arbeitgeber auch nicht ersetzt werden.
Wirkung auf den CO2-Ausstoß umstritten
Die Studie bezweifelt, ob ein Kurzstreckenflugverbot innerhalb Österreichs grundsätzlich geeignet ist, um Emissionen zu senken. Dazu S4F: „Bezüglichder Kurzstreckenflugverbotefällt auf, dass sowohl die vorliegende Studie als auch die Luftfahrtstrategie 2040+ des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf mögliche Verlagerungseffekte hinweisen, die Studie aber keine Schätzung von tatsächlichen Verlagerungen von CO2-Emmissionen vornimmt, was allerdings wünschenswert wäre.“ Die drei Argumente der Studie, mit denen die CO2-Einsparung durch Flugverbote bezweifelt wird, werden von S4F kritisch beleuchtet.
Das erste Argument ist, dass Fluggäste wegen der Verbote auf Strecken ausweichen könnten, die nicht dem EU-Emissionshandelssystem, dem weltgrößten Markt für Kohlenstoffemissionen, unterliegen, und damit Emissionen in Drittstaaten entstehen könnten. Die Studie liefere aber keine Evidenz, dass dies im Falle des Kurzstrecken-Flugverbotes in Österreich tatsächlich passiert.
Flugverkehr trägt maßgeblich zum Treibhauseffekt bei
Das zweite Argument ist, dass der internationale Luftverkehr einen vergleichsweise kleinen Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen von nur ca. 3% hat. Dies sei grundsätzlich richtig. Trotzdem lasse sich durch das Vermeiden von Kurzstreckenflügen eine beachtliche Menge an Emissionen reduzieren, was aufgrund der zunehmenden Dramatik des Klimawandels auch besonders akut und notwendig erscheine. „Kurzstreckenflüge sind die emissionsintensivste und klimaschädlichste Möglichkeit zu reisen. Laut den Daten des Umweltbundesamts verursacht ein Inlandflug durch hohen Kraftstoffverbrauch bei Start und Landung bei durchschnittlicher Auslastung min. 4-mal mehr CO2[2]-Equivalente pro Personenkilometer als durchschnittliche Verbrenner-PKWs mit einer Person an Board (wobei hier eine mögliche PKW-Elektrifizierung noch nicht mit berücksichtig ist). Der Zug verursacht sogar nur ein Hundertstel der Emissionen des Inlandflugs. Zudem sind auf den Strecken nach Wien und München diverse Shuttle-Taxis unterwegs, die durch Mehrfachbesetzung relativ CO2-effizient fahren.“
Das dritte Argument der Studie ist, dass in der Zukunft ein wachsender Anteil des Flugkraftstoffs aus nachhaltigem Flugtreibstoff bestehen muss. Emissionsarmes Fliegen sei also prinzipiell in Sichtweite. Doch Technologien zur Emissionsreduktion würden derzeit nicht eingesetzt und die Vorteile dieser Technologien seien derzeit noch nicht nutzbar. Hier besteht die Gefahr des ‚Scheinklimaschutzes bzw. des ‚Greenwashings‘, so die S4F-Stellungnahme.
Die Conclusio von S4F: „Die Studie erfüllt ihre eigenen Zielsetzungen nur teilweise.“
Kritisiert werden auch die medialen Interpretationen der Studie. So heißt es seitens der Wirtschaftskammer: „Erste Evaluierungsstudie zum Verbot von Inlandsflügen zeigt: Mehr Autoverkehr statt CO2-Reduktion und regionale Standorte schlechter erreichbar.“ Diese Aussage sei, wie dargestellt, durch Daten des Umweltbundesamtes widerlegt. Auch der Untertitel der Pressemeldung „Inlandsflüge transportieren zu mehr als 90 % Umsteigepassagiere – Wirtschaftsstandort Österreich verliert an Wertschöpfung“ sei irreführend. Hierbei werde der Gewinn der Bahnwirtschaft nicht berücksichtigt. Gewisse Verluste seien zwar plausibel, aufgrund der mangelhaften Datenbasis aber schwer zu beziffern.
Die Conclusio von S4F: Die medialen Aussagen zur CO2-Vermeidung sind durch die Studie nicht vollständig gedeckt.
Schließlich kritisieren die S4F mangelnde wissenschaftliche Standards, die da wären:
- Keine klare Methodenbeschreibung (Datenquellen, Analysemethoden, Zielgruppen, Stichproben, Fokusgruppe, Expertenpanels etc.)
- Intersubjektivität: wesentliche Aussagen sollten autorenunabhängig und zielgruppenrepräsentativ replizierbar sein
- Transparenz: Alle zugrundeliegenden Daten sollten für eine Überprüfung zugänglich sein (Informationsfreiheit)
- Unabhängigkeit: Studienautoren und verwendete Datengeber sollte keine Interessenskonflikte bzgl. der Studienergebnisse haben
- Peer-Review: Die Studie sollte von unbeteiligten FachkollegInnen geprüft werden
Zusammenfassend wird festgehalten:
„Die vorliegende Studie ist eher ein Strategiepaper für die lokale flugbezogene Wirtschaft. Aussagen zur Lenkungswirkung auf das Reisemittelwahlverhalten der Bevölkerung können kaum gemacht werden.“ Die Scientist4Future Salzburg regen an, künftige Studien nach klassischen wissenschaftlichen Kriterien anzugehen und die Zielsetzungen zu erweitern. Bei einer wirtschaftlichen Betrachtung müssten auch Profite von Bahnunternehmen berücksichtigt werden. CO2-Bilanzierungen müssten auf globalem Level betrachtet werden. Mögliche lokale Verbesserungen durch ein verringertes Flugvolumen (gerade in den Randzeiten früh morgen und spät abends) für die Flughafenanrainer (hohe Lärm und Emissionsbelastung) und den gesamten Salzburger Zentralraum sollten ebenso berücksichtigt werden. Flughäfen im (Teil)besitz von Bundesländern/Städten – wie in Salzburg – sollten an einer solchen Gesamtbetrachtung besonderes Interesse haben.
[1] In der Studie wird außerdem auf eine mögliche empirische Befragung verwiesen, die auf diese Nutzungsprofile Bezug nimmt. Die Daten dieser Befragung werden jedoch nicht weiter erklärt und wurden Scientist4Future Salzburg nicht zur Verfügung gestellt.
[2] https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/mobilitaet/daten/ekz_fzkm_verkehrsmittel.pdf