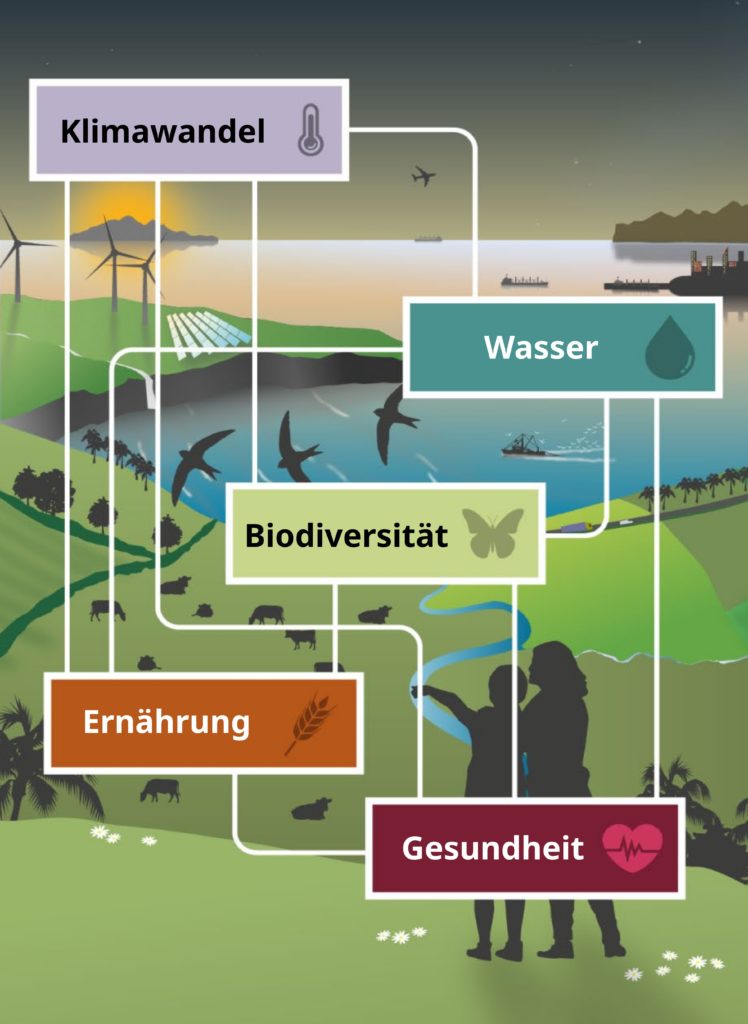Lesedauer 7 Minuten.
Mitglieder der Scientists4Future Österreich geben Empfehlungen für Sachbücher, Essays und Romane zur Klimakrise, Biodiversitätskrise und zu anderen Krisen.1
SACHBÜCHER
Thomas Brudermann, Die Kunst der Ausrede. Warum wir uns lieber selbst täuschen, statt klimafreundlich zu leben. Oekom Verlag München, 2022
Der Autor ist Professor an der Universität Graz und Scientist4Future. Er fragt, was klimafreundliches Handeln so schwer macht und was es aus Sicht der Psychologie für eine nachhaltige Gesellschaft braucht. Die feinen Cartoons mit freundlichen Capibaras machen die Lektüre besonders erfreulich, eine Tabelle mit allen Ausreden und möglichen Umgangsweisen damit am Ende des Buches sind eine ausgezeichnete Grundlage für die Kommunikation mit anderen. Das Werk wurde 2023 mit dem Eunice Foote Preis für Klimakommunikation ausgezeichnet. (VW)
Daniel Ennöckl (Hrsg), Klimaschutzrecht im Querschnitt von Wissenschaft und Praxis, Verlag Österreich, 2023
Dieses Handbuch bietet eine umfassende, fundierte Aufbereitung der Querschnittsmaterie Klimaschutzrecht. In 21 Kapiteln behandeln Autorinnen aus Wissenschaft und Praxis alle wesentlichen Bereiche dieses dynamischen Rechtsgebiets: von den völker-, unions- und verfassungsrechtlichen Grundlagen des Klimaschutzes über Emissionshandel, Energieeffizienz und erneuerbare Energien bis hin zu Klimaklagen, Zivilgesellschaft und Zivilrecht. Als erste derartige Gesamtdarstellung in der österreichischen Rechtsliteratur wendet sich dieses Handbuch an alle Rechtsanwenderinnen, Wissenschaftler*innen und Studierenden, die sich einen Überblick über die Rolle des Klimaschutzes im Recht verschaffen oder ihr einschlägiges Wissen vertiefen wollen.
Hans Holzinger, Wirtschaftswende, Oekom 2024
Das Buch macht deutlich, dass es mittlerweile zahlreiche Transformationsansätze gibt, und es beschreibt, wie die Wirtschaftwende gelingen könnte. Es richtet sich an ein breites Publikum, um die Zukunftsvorschläge über die Fachwelt hinaus bekannt und diskutierbar zu machen. Der Autor benennt die Nichtnachhaltigkeit unserer aktuellen Wirtschafts- und Lebensweise, er skizziert aber insbesondere die vielen Neuansätze in den Bereichen Energie und Ernährung, Mobilität und Stadt, Finanzen und Steuern sowie Unternehmen und Konsum. Deutlich wird, wie all diese Wenden mit Wirtschaft zu tun haben. (MA, ganze Rezension hier)
Naomi Oreskes, Erik M. Conway: Die Machiavellis der Wissenschaft: Das Netzwerk des Leugnens. Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2014
Ein Klassiker, der die Vorgangsweise großer Konzerne seziert, die Zweifel säen, um ihre Geschäfte nicht zu gefährden, dargestellt unter anderem an der Tabakindustrie. Der englische Titel „Merchants of Doubt“ (etwa: Die Händler des Zweifels) trifft besser als die deutsche Übersetzung. Leider inzwischen vergriffen, vielleicht antiquarisch erhältlich. (VW)
Friederike Otto, Wütendes Wetter. Auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme. Ullstein Verlag, Berlin 2019
Die Autorin ist Professorin in Oxford, hochrangiges Mitglied des Weltklimarates und die Mitbegründerin der Zuordnungsforschung. Sie erklärt verständlich und erzählt packend die Geschichte der Entwicklung ihrer Forschungsrichtung entlang einiger Katastrophen, für die es ihrem Team gelang, den Beitrag der Treibhausgasemissionen zu berechnen. Spannend, informativ, erklärend ohne belehrend zu wirken. (VW)
Corine Pelluchon, Manifest für die Tiere, aus dem Französischen übersetzt von Michael Bischoff, C.H. Beck, München 2020
In ihrem kurzen und gut zu lesenden Buch befasst sich die Philosophin Corine Pelluchon mit der uns so selbstverständlich erscheinenden Unterdrückung von Tieren. Wie wir mit nicht-menschlichen Tieren umgehen betreffe im Kern die Frage nach unserer Menschlichkeit. Dabei bleibt sie nicht bei einer theoretischen Auseinandersetzung, sondern gibt auch konkrete Tipps und benennt (Zwischen-)Ziele, die einen – sozial gerechten – Ausweg aus dem System der Misshandlung und Ausbeutung von Tieren aufzeigen. (VW)
Michael Rosenberger, Was der Seele Leben schenkt. Spiritualität aus Erde. Echter Verlag Würzburg, 2020
Der Autor ist Professor für Moraltheologie an der Katholischen Privatuniversität Linz; von ihm stammen zahlreiche Veröffentlichungen zu umweltethischen Fragen. Er wirkt bei S4F im Fachkollegium mit. Er vermittelt eine erdgebundene, allen Menschen zugängliche Spiritualität, die von den menschlichen Grunderfahrungen ausgeht, um daraus Orientierung für die praktische Lebensgestaltung zu gewinnen. Eine Buch, das die Seelsorge, als Sorge um die Menschen, die sich engagieren und dabei ausbrennen, als Sorge um die Menschen, die aus Angst nicht handeln, als Sorge um alle Menschen, ins Zentrum stellt. Gut lesbar, knapp, und ein ganz anderer Zugang zur Klimakrise als üblich. (VW)
ESSAYS
Rachel Carson, Silent Spring, Houghton Mifflin, 2002 (Englisch)
Wohl eines DER Öko-Bücher, welches maßgeblich für die Gründung der US EPA war. (MS)
Gregory Fuller, Das Ende – Von der heiteren Hoffnungslosigkeit im Angesicht derökologischen Katastrophe, Meiner, 2017
Obgleich erstmals 1994 erschienen ist dieser Essay unverändert aktuell (auch wenn heute manche Aspekte fachlich anders gesehen werden) und bietet viel Nachdenkstoff zum ethischen Umgang mit der Umweltkrise.
Amitav Ghosh, Die große Verblendung. Der Klimawandel als das Undenkbare. Karl Blessing Verlag, München 2017
Der indische Autor, studierter Sozialanthropologe, der in New York lebt, schreibt seit Jahrzehten über Indien. Hier geht es aber – durchaus aus postkolonialer Perspektive, um mehr: Warum ist der Klimawandel kein Thema der Literatur? Dieser Essay argumentiert, dass die Kunst sich zu wenig mit dem Klimawandel beschäftige. Das mag sich seit 2017 geändert haben, die Grundfrage, ob die Menschheit verblendet sei, ist nach wie vor aktuell. Sprachlich eleganter Essay von einem großen Autor. In seinem Buch Gun Island (Dt. Die Inseln, Karl Blessing Verlag 2019) nimmt er seine Herausforderung an, Klimaflüchtlinge und Umweltaktivismus spielen eine große Rolle in diesem Roman. (VW)
Daniel R. Headrick, Macht euch die Erde untertan – Die Umweltgeschichte des Anthropozäns,
wbg Theiss, 2021
Um die heutigen multiplen Umweltkrisen besser einordnen zu können, ist diese Zusammenschau unbedingt lesenswert.
Bruno Latour/Nikolaj Schultz, Zur Entstehung einer ökologischen Klasse, edition suhrkamp, 2022
Latour und Schultz erörtern aus soziologischer Sicht, warum es der Bildung einer “ökologischen Klasse” (analog zur Bildung der Arbeiterklasse) bedarf.
Martha Nussbaum, Gerechtigkeit für Tiere wbg Theiss, 2023
Eine rechtliche, philosophische und ethische Grundlegung primär in Bezug auf unseren Umgang mit Tieren – mit vielem, was man darüber hinaus weiterdenken kann.
Verena Winiwarter, Der Weg zur klimagerechten Gesellschaft. Sieben Schritte in eine nachhaltige Zukunft, picus, Wien 2022
Die Autorin ist Umwelthistorikerin und engagiert sich bei S4F im Fachkollegium. Aus einer „Wiener Vorlesung“ ging dieser kurze Text hervor (72 S), der Grundrechtsdemokratie, die Auflösung der Öffentlichkeit durch soziale Medien und ihre Algorithmen, Daseinsvorsorge und fossile Energie in einen unerwarteten Zusammenhang bringt. Sie schlägt einen Verfassungskonvent vor, der mit einer klimagerechten Verfassung die Grundlage für eine klimagerechte Gesellschaft legt. (VW)
Schule und Kinder
David Nelles & Christian Serrer, Kleine Gase – Große Wirkung. Spiegel Verlag, 2018
Für Einsteiger*innen: Das Buch eignet sich für Laien, Schulen, Lehrer*innen, um auch schnell mal zwischendurch einen Informationshappen gut aufbereitet aufzunehmen; es greift gut fundiert viele Themen auf, ohne zu überfordern.
Andri Snaer Magnason (Author), Aslaug Jonsdottir (Illustrator), Julian Meldon D’Arcy (Translator), The Story of the Blue Planet, Triangle Square (Englisch)
Sehr nett gestaltetes Kinderbuch, das neben vielen anderen Themen auch eine ökologische Message beinhaltet. (MS)
ROMANE
Margaret Atwood, Oryx und Crake, Piper, 2017
Atwood verbindet einen Thriller in einer künftigen Welt der Klimakatastrophe mit einem schmerzhaften Kommentar zu unserer Zeit.
T. C. Boyle, Blue Skies, Carl Hanser, 2023
Amerika in einer möglichen nahen Zukunft. Dystopisch, bissig und brillant.
Frank Herbert, Der Wüstenplanet, Heyne, 2016 und folgende
Bestimmt schon bekannt durch den Film, das Buch ist aber auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Besonders Buch 1 ist aus ökologischer Sicht spannend. Für die ganze erste ökologische Transformation des Planeten muss man allerdings Buch 1 bis 4 lesen. (MS)
Maja Lunde, Die Geschichte der Bienen, btb, München 2017
Die Norwegerin ist als Autorin von Romanen und Drehbüchern inzwischen auch außerhalb Europas bekannt, dieser Roman ist der erste Teil des „Klimaquartetts“, von dem bisher drei Bände erschienen sind. Die Geschichte der Bienen zählt zum Packendsten, was es an Klimaromanen gibt. Eine in synthetischer Kleidung schwitzende chinesische Arbeiterin, die mühsam mit der Hand Obstbäume bestäubt wird zur Hauptfigur eines der ineinander verwobenen Teile dieses Romans, der die gesellschaftlichen Konsequenzen des Artensterbens greifbar macht und ganz nebenbei auch noch eine spannende Wissenschaftsgeschichte erzählt. (VW)
Maja Lunde, Die Geschichte des Wassers, btb, München 2018
Was geschieht, wenn Wasser durch die Klimakrise zu einem unerreichbaren Gut wird? Gewalt, Flucht, verlassene Landstriche, ein Schiff auf dem Trockenen und ein unerwarteter lebensrettender Fund machen diese Geschichte zu einer abenteuerlichen Lektüre. Zweiter Teil des Klimaquartetts, macht wie der erste band die Konsequenzen für Einzelne und Staaten (mit-)fühlbar. Wie im Bienen-Band werden mehrere Erzählstränge ineinander verwoben. (VW)
Maja Lunde, Die letzten ihrer Art, btb München, 2019
Geht es hier um die Przewalskipferde, ihre Geschichte, ihre Erhaltung durch auswildern oder darum, dass das Überleben für Menschen Mitte des 21. Jahrhunderts immer schwieriger werden wird? Wie in den ersten beiden Bänden des „Klimaquartetts“ der Autorin werden mehrere Geschichten miteinander verknüpft, die Schauplätze reichen von der Mongolei bis Norwegen. (VW)
Günther Neuwirth, Vogelstimmen, Edition Keiper 2024
Der Ornithologe Rémy erforscht im Wald die Gesänge der Vögel, die Informatikerin Verena sammelt im Südpolarmeer Daten, der Gitarrist Alwin verbringt sein Leben in Tonstudios, die Australierin Karlene zieht mit ihrer Geige durch Europas Städte, Harald und Katja erleben die Abschaffung der Demokratie am eigenen Leib. Und an den Stränden des Mittelmeers hungern immer mehr Mitglieder der friedlichen Sekte der Weißen Tücher. Was macht der nahende Kollaps der Ökosphäre mit den sechs jungen Menschen? Was tun, wenn Umweltschutz als Terrorismus gilt? Wo bleibt das Glück inmitten des ausbrechenden Irrsinns? (MA)
Richard Powers, Die Wurzeln des Lebens, aus dem Englischen übersetzt von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié, S. Fischer, Frankfurt am Main 2020
Der US-amerikanische Schriftsteller Richard Powers widmet sich in seinen Werken oft naturwissenschaftlichen und philosophischen Themen und Fragen. Sein Roman „Die Wurzeln des Lebens“, der beides verknüpft, wurde 2019 unter anderem in der Kategorie Unterhaltung als Wissensbuch des Jahres ausgezeichnet. Auf fesselnde Weise beschreibt Powers in ihm, wie das Leben aller Protagonist*innen, der menschlichen wie nicht-menschlichen, so wie das titelgebende Wurzelgeflecht der Bäume miteinander verknüpft ist. Alle eint der Kampf für den Schutz der Bäume vor Abholzung und die Auseinandersetzung mit dem zuwiderlaufenden politischen und gesellschaftlichen Dynamiken. Dabei lässt sich einiges über die auch für uns so lebenswichtigen Bäumen lernen, die manch eine*r nach der berührenden Lektüre sicherlich mit anderen Augen sieht. (VW)
Kim Stanley Robinson, New York 2140, Heyne 2018
Der amerikanische Science Fiction Spezialist hat schon mehrfach Preise für „Eco-Fiction“ gewonnen. “Climate Fiction” gibt es inzwischen wie Sand am Meer, aber ein Buch wie dieses, das auf über 800 Seiten einen weiblichen Internetstar im Luftschiff Eisbären in die Antarktis fliegen lässt, was Artenschützer nicht nur mit Begeisterung erfüllt, in dem zwei Computergeeks eine Entdeckung machen, die sie in Lebensgefahr bringt, in dem eine der Hauptrollen das durch den Meeresspiegelanstieg zum Archipel von Hochhausspitzen gewordene Manhattan spielt, in dem Finanzspekulation in der Gezeitenzone auf Hochtouren läuft und einzig und allein die Isländer, die immer schon etwas mißtrauischer waren, noch über alle ihre Personenstandsdaten verfügen, ein Buch wie dieses gibt es nicht alle Tage. Die unvermeidliche Liebesgeschichte ist eine der wenigen Schwächen dieses nicht nur fabulierlustigen, sondern auch sehr informativen Buches: denn aus der Zukunft wird auf die Vergangenheit, unsere Gegenwart, geblickt – das gibt Anlaß für Klimabildung aller Art. Leichtfüßig, witzig und trotzdem durchaus zum Nachdenken anregend. An diesem Buch scheiden sich die Geister, aber wer dicke Bücher, die vor Leben und Details strotzen, schätzt und wer New York kennt und vielleicht sogar mag, ist hier gut beraten. (VW)
Kim Stanley Robinson, Das Ministerium für die Zukunft, Heyne 2023
Das erste Kapitel dieses im Jahr 2025 spielenden Romans ist hart. Die Unbarmherzigkeit einer Hitzewelle in Indien lässt niemanden kalt. Danach wird es weniger drastisch. Barack Obama und Bill Gates haben dieses Buch beide empfohlen. Es ist trotzdem lesenswert, im Vergleich zu New York 2140 vom selben Autor deutlich weniger verästelt, aber kunstvoll und kenntnisreich erzählt. Pflichtlektüre für alle, die sich fragen, wie das mit der Klimakrise im globalen Süden denn so sein wird. (VW)
Empfehlungen von unseren Follower:innen
Dave Goulsen, Stumme Erde – Warum wir die Insekten retten müssen, Hanser 2022
Dave Goulsen, The Garden Jungle, Penguin Books 2020
Bibliotheken
Südwind Bibliotheken: https://www.suedwind.at/bildungsangebot-und-globales-lernen/suedwind-bibliotheken/
Folge uns:







Teile das: