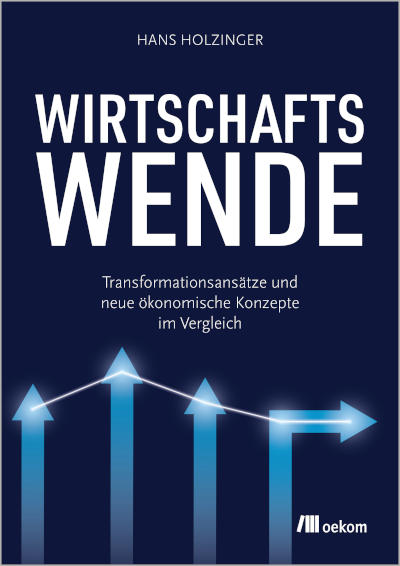von Martin Auer
Alle reden vom Klima, aber niemand redet vom Sand. Sand gibt es doch wie Sand am Meer. Leider nein. Wenn die Bautätigkeit so weiter geht wie bisher, gibt es 2050 keinen für die Zementherstellung brauchbaren Sand mehr. Schon jetzt ist Sand knapp und so teuer, dass kriminelle Banden minderwertigen und illegal geförderten Sand an die Bauindustrie verkaufen. Absurd, oder? Tatsächlich gibt es nur eine Ressource, von der wir mehr verbrauchen: Wasser. Und auch das wird knapp, nämlich das Wasser im Boden. Und wer redet von der Phosphorkrise? Phosphor ist Bestandteil allen organischen Lebens. Deshalb braucht man ihn ja für Düngemittel. Der Preis von Rohphosphor hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Die Vorräte reichen noch 300 Jahre – wenn’s gut geht. Wenn nicht, dann noch 100 Jahre. Das sind nur ein paar der Krisen, von denen weniger gesprochen wird als von der Klimakrise und dem Artensterben. Bei letzterem geht es übrigens nicht nur um Tiger und Eisbären. Das Artensterben findet zu einem großen Teil unter den Bodenlebewesen statt, die die Erde erst fruchtbar machen. Und die letzte Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, dass das immer tiefere Vordringen in noch unberührte Natur uns vom Tier auf den Menschen überspringenden Krankheiten aussetzt, die sich wie Buschfeuer um den Globus verbreiten und auch vor Reichen und Mächtigen nicht Halt machen.
Alle diese Krisen belegen, dass wir mit unserem Ressourcenverbrauch und unserem Verbrauch an Senken für unsere Abfälle (z . B. CO2) am Limit sind. Wir? Wer oder was hat uns an diese Grenzen, beziehungsweise schon weit über die ökologischen Belastungsgrenzen hinaus geführt? Bei der dreitägigen „Beyond Growth Konferenz“, die als Teil eines EU-Projekts kürzlich in Wien stattgefunden hat (Die Eröffnung war im Parlament unter den Auspizien des Bundespräsidenten und des Parlamentspräsidenten), waren sich die Mehrheit der Speaker und des Publikums einig: Der kapitalistische Wachstumszwang ist es, der uns ans Limit gebracht hat.
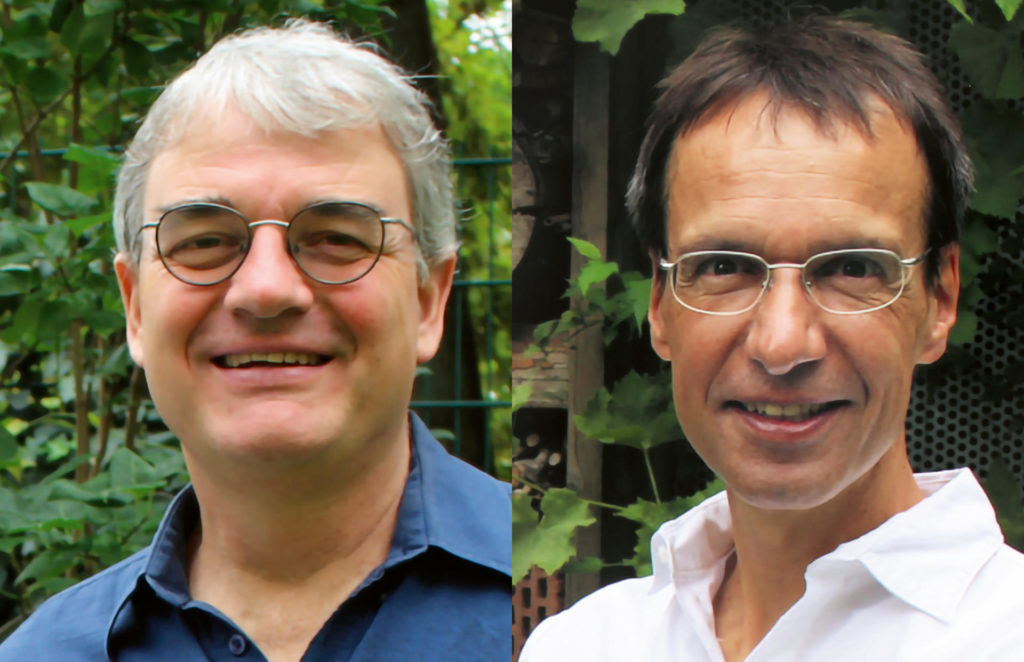
© Bärbel Högner | © SBK
„Kapitalismus am Limit“ heißt auch das neue Buch der Politikwissenschaftler Ulrich Brand und Markus Wissen. Bekannt geworden sind die beiden Autoren durch ihren Bestseller von 2017 über die „Imperiale Lebensweise„. Die Autoren behaupten nicht, dass das Ende des Kapitalismus unmittelbar bevorsteht. Sie zeigen auf, wie der Kapitalismus seine eigene Existenz untergräbt. Die billige Natur, an der er sich Jahrhunderte lang bedient hat, ist teuer geworden, Ressourcen sind heftig umkämpft. Viele Staaten wollen ihre Ökonomien dekarbonisieren. Gerade das führt aber dazu, dass geopolitische Rivalitäten sich immer mehr an Rohstoffen, die für eine ökologische Modernisierung notwendig sind, entzünden. Öko-imperiale Spannungen nennen das die Autoren. Lange Zeit konnten die Krisen verborgen, das heißt externalisiert werden. Die sozial-ökologischen Kosten wurden dem globalen Süden aufgehalst; den Frauen im Süden wie im Norden, die unbezahlte Reproduktionsarbeit (Care, Sorgearbeit) leisten; und den künftigen Generationen. Immer neue Sphären der Rohstoff-Extraktion wurden erschlossen (zum Beispiel die Tiefsee). Doch auf allen diesen Gebieten wird es eng. Aufstrebende Ökonomien wie die chinesische oder die indische konkurrieren mit den alteingesessenen kapitalistischen Ökonomien sowohl um Rohstoffe als auch um Märkte. Immer mehr Gruppen wehren sich dagegen, sich die Kosten aufhalsen zu lassen. Frauen wehren sich dagegen, dass sie die Last der unbezahlten Care-Arbeit tragen sollen, indigene Völker kämpfen gegen Bergwerksbetriebe und Ölförderungen, die ihre Umwelt bedrohen. Umweltbewegungen beschränken sich nicht mehr auf Appelle an „die Politik“ sondern wehren sich aktiv, etwa durch Besetzungsaktionen wie die mehr als ein Jahr dauernde Besetzung des Dorfes Lützerath, das einem Braunkohle-Tagebau weichen sollte. Im globalen Süden wird die Forderung nach Reparationen für die Folgen des Klimawandels und die Schäden durch den Kolonialismus immer lauter.
Fossiler oder grüner Kapitalismus?
Während konservative Kräfte sich für den Fortbestand der fossilen Wirtschaft einsetzen, setzen andere auf einen „grünen Kapitalismus“, der ohne ständig steigenden Verbrauch von Ressourcen und Senken auskommen soll. Sie setzen auf Digitalisierung, CO2-Abscheidung und Speicherung, das E-Auto, Effizienzsteigerung, Recycling, und so weiter. Davon versprechen sie sich – und uns – eine Abkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch. Ein ganzes Kapitel widmen die Autoren dem European Green Deal. Doch „grünes Wachstum“ findet nicht statt. Es gibt zwar Gebiete und Zeiträume, in denen die CO2-Emissionen zurückgehen während das Brutto-Inlandsprodukt wächst, doch dieser Rückgang ist weit von dem entfernt, was für die Klimaneutralität Mitte des Jahrhunderts notwendig wäre. Die Extraktiomn von Bodenschätzen wird von Kohle, Öl und Gas auf Kupfer, Bauxit, Lithium, Kobalt, seltene Erden usw. verlagert, und zwar wiederum zum großen Teil auf Kosten der Natur und der Bevölkerung des globalen Südens, und die Konkurrenz darum verschärft geopolitische Spannungen.
Die autoritäre Rechte
Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Erstarken der autoritären Rechten in der Krise der imperialen Lebensweise. In Europa sind die CO2-Emissionen seit 1990 um 29 % gesunken. Das ist ja positiv. Doch wer hat seine Emissionen wirklich eingeschränkt? Der Climate Inequality Report zeigt: Die Pro-Kopf-Emissionen der ärmeren 50 Prozent sind um 30,6 Prozent gesunken, die des reichsten einen Prozent um 1,7 %. Die ärmeren 50 Prozent verursachen durch ihren Konsum pro Kopf 5 Tonnen CO2 im Jahr, die mittleren 40 Prozent 10,7 Tonnen, die reichsten 10 Prozent durchschnittlich 29,4 Tonnen und das reichste eine Prozent 90,6 Tonnen pro Kopf und Jahr. In Österreich, wo die Emissionen kaum gesunken sind, hat das reichste eine Prozent seine Pro-Kopf-Emissionen um 45 % gesteigert, und nur die Emissionen der ärmsten 50 Prozent sind gesunken. Es gibt also einen krassen Unterschied zwischen Oben und Unten. Die autoritäre Rechte aber zieht die Grenze nicht zwischen Oben und Unten, sondern zwischen Innen und Außen: „Wir“ gegen Migrant:innen und Geflüchtete, und setzt auf die Stärkung einer in die Krise geratenen Männlichkeit. In gewisser Weise ist das ein Protest von rechts gegen Globalisierung und Neoliberalismus, „mit einem autoritären, militaristisch-männlichen und menschenfeindlichen Angebot, das Menschen entlang von Kriterien wie Herkunft oder Religion sortiert, mit Kategorien wie ‚das Volk‘ vermeintlich Einheitlichkeit schafft und verlorengegangene Regierbarkeit zurückzugewinnen verspricht.“ Es ist ein Versuch, „die imperiale Lebensweise autoritär zu stabilisieren“. Doch die autoritäre Rechte bricht nicht wirklich mit dem Neoliberalismus. Sie setzt die Politik der Privatisierung und Deregulierung in vielen Bereichen fort.
Die imperiale Lebensweise ermöglichte in den Ländern des Nordens seit dem Ende des zweiten Weltkriegs einen Klassenkompromiss: Die Arbeitnehmer:innen konnten sich einen Anteil an der durch fossile Energie und Neokolonialismus ermöglichten Steigerung der Produktion von Konsumgütern erkämpfen. Der Fortbestand der kapitalistischen Ordnung in Form der Konsumgesellschaft war von der Kaufkraft der Massen abhängig. Doch der Kompromiss beginnt zu bröckeln. Die Krise der Lebenshaltungskosten, die Verluste von Arbeitsplätzen und Einkommen durch die Corona-Pandemie, die sogenannte Finanzkrise von 2008 fördern berechtigte Verlustängste. Und diese Ängste werden verstärkt durch die Ahnung, dass es im Ganzen so nicht weitergehen kann. Die autoritäre Rechte ergreift rhetorisch Partei für die „kleinen Leute“, verteidigt sie vor der Bedrohung von außen durch „Globalisten“ einerseits, und anderseits vor der Bedroh2ung durch kleine Leute, die noch schlechter dran sind: Migrant:innen und Geflüchtete, die angeblich in unser Sozialsystem einwandern und unsere Kultur bedrohen. In der Praxis aber stimmt sie für Politiken, die auf Kosten eben dieser kleinen Leute gehen, bzw. setzt sie dort durch, wo sie sich an die Macht spülen hat lassen.
Was kommt danach?
Das letzte Kapitel widmet sich – anders ist es ja nicht zu erwarten – den Möglichkeiten zur Überwindung der auf Konkurrenz und Wachstumszwang beruhenden Wirtschaftsweise. Unter anderem wird hier der wachsenden Degrowth- und Postgrowth-Bewegung eine wichtige Rolle zuerkannt und Bewegungen wie Ende Gelände, Fridays for Future oder Letzte Generation. Umweltbewegungen und soziale Bewegungen rücken näher zusammen. Letzten Monat demonstrierte in Wien die Klimabewegung gemeinsam mit den Busfahrer:innen in der Gewerkschaft vida unter dem Motto „Wir fahren gemeinsam“ für bessere Arbeitsbedingungen bei den privaten Buslinien. Die Verkehrswende kann schwerlich gelingen, wenn Beschäftigte im öffentlichen Verkehr an der Endstation nicht einmal ein richtiges Klo vorfinden.
Jenseits vom Wachstum
Und das bringt uns zurück zur „Beyond Growth Konferenz“. Wer von Überwindung des Kapitalismus spricht, von der Notwendigkeit, die Wirtschaft zu demokratisieren und planbar zu machen, und die Produktion von Gütern und die Bereitstellung von Leistungen zu vergesellschaften, bekommt bekommt schnell zu hören: „Was willst du denn? Eine Planwirtschaft mit Schlangen vor den Geschäften? Eine staatliche Plankommission, die Normen für Schuhe nach Gewicht plant, worauf nur genagelte Bergschuhe produziert werden, um den Plan schneller zu erfüllen?“ Die FPÖ bezichtigte kürzlich gar auf ihren Wahlplakaten die EU des „Öko-Kommunismus“. Doch niemand wünschte sich auf dieser Konferenz eine staatliche Plankommission. Eine Vielzahl von Wegen und möglichen Modellen wurde vorgestellt und diskutiert. Ein Thema, das sich durch die meisten Modelle durchzog, ist: Demokratisierung der Wirtschaft bedeutet ein aktives Mitspracherecht der Beschäftigten und der Konsument:innen darüber, was, wo, wie und von wem produziert werden soll. Die Abstimmung an der Supermarktkasse reicht da nicht. Die Mitbestimmung kann auf verschiedenen Ebenen geschehen. Natürlich auch auf staatlicher Ebene. Der Ausbau des Sozialstaats und eine bedingungslose Grundversorgung für alle spielt in den meisten Modellen eine bedeutende Rolle. Aber auch auf Betriebsebene ist Mitbestimmung gefordert, und zwar weit über das, was Betriebsräten heute zugestanden wird. Als Betriebsräte in einem österreichischen Rüstungsbetrieb zum Beispiel vorgeschlagen haben, statt Panzern Löschfahrzeuge zur Bekämpfung von Waldbränden zu produzieren, wurde das vom Unternehmen einfach abgeschmettert. Das soll es in einer demokratischen Wirtschaft nicht geben. Als die Beschäftigten des Rüstungsbetriebs Lucas Aerospace in den 1970er Jahren von einer Kündigungswelle bedroht waren, forderten sie das „Recht auf gesellschaftlich nützliche Arbeit“ und entwickelten einen Plan, was sie mit ihren Fähigkeiten und der vorhandenen Ausrüstung machen konnten: Windräder, Wärmepumpen, Heimdialysegeräte, Go-Carts für behinderte Kinder… Als die Beschäftigten des Autozulieferers GKN Automotive in Campo Bisenzio bei Florenz am 9. Juni 2021 per Email gekündigt wurden, besetzten sie die Fabrik, beriefen eine Betriebsversammlung in Permanenz ein und beschlossen, eine Genossenschaft zu gründen, die statt Achsen für schwere Autos Lastenfahrräder produziert. Die Prototypen sind in Florenz schon unterwegs.
Beeindruckend war der Bericht über einen kleinen Laden in Wien Ottakring: den Mila Mitmach-Supermarkt bei der Beyond Growth Konferenz. Er gehört denen, die dort einkaufen, einer Genossenschaft von derzeit 600 Mitgliedern. Jedes Mitglied arbeitet alle vier Wochen drei Stunden im Laden. Ein Mitglied der Genossenschaft erklärte, warum nur Mitglieder dort einkaufen dürfen: Die Mitglieder arbeiten für sich selber. Darum müssen sie keinen Gewinn machen. Sie müssen die Kundschaft nicht motivieren, mehr zu kaufen, als sie eigentlich will, sie nicht mit Muzak in Einkaufsstimmung bringen. Obst und Gemüse wird einzeln verkauft, niemand muss eine Kilopackung kaufen, wenn er oder sie nur eine Karotte braucht. Die Genossenschaft muss nicht mit anderen Firmen um Kunden konkurrieren, weil die Genossenschafter:innen ihre eigenen Kunden sind. Sie schlagen einheitlich 30 % auf den Einkaufspreis auf, und was sie so einnehmen, dient dazu, den Betrieb zu erhalten und zu erweitern. Über das Sortiment entscheiden die Mitglieder. Sie entscheiden, ob sie beim Einkauf mehr Gewicht auf den Preis oder auf die Qualität legen. Sie wollen wachsen, weil sie mehr Menschen diese Möglichkeit, Qualität zu niedrigen Preisen zu kaufen, geben wollen, aber sie sind nicht gezwungen dazu. Tatsächlich werden sie demnächst einen „richtigen“ Supermarkt eröffnen.
Mila ist ein Modell im Kleinen für eine solidarische Wirtschaft, eines von vielen unterschiedlichen Modellen, die aber gut nebeneinander existieren und einander ergänzen können. Allen diesen Modellen ist gemeinsam, dass nicht das produziert wird, was den meisten Profit bringt, sondern das, was Nutzen für die Gemeinschaft bringt. Lässt sich so ein Modell skalieren? Die Park Slope Food Coop betreibt den größten Supermarkt von New York und hat 17.000 Mitglieder. Vielleicht sind Kooperativen von Kooperativen der Weg, auch größere wirtschaftliche Zusammenhänge demokratisch zu organisieren. Die Kooperative hat auch den Vorteil, dass sie schon im jetzigen System bestehen kann. Die Suche nach Alternativen zum Kapitalismus ist noch lange nicht abgeschlossen und ganz sicher gibt es nicht nur eine.
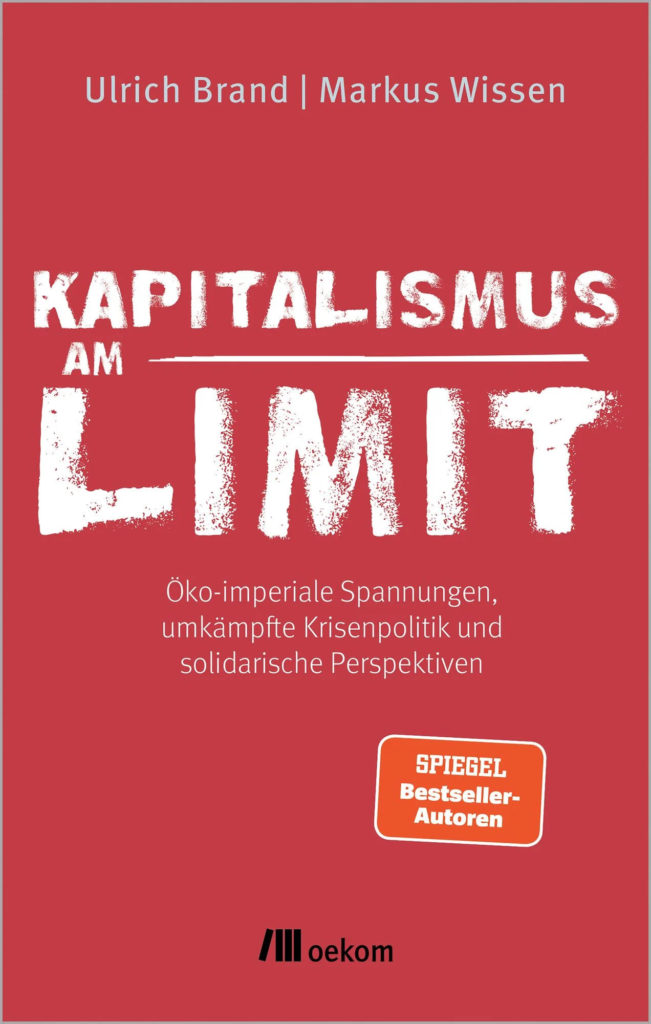
Ulrich Brand, Markus Wissen
Kapitalismus am Limit
Öko-imperiale Spannungen, umkämpfte Krisenpolitik und solidarische Perspektiven.
ISBN: 978-3-98726-065-0
Softcover, 304 Seiten (auch als Epub oder PDF)
Titelbild: Martin Auer mithilfe von KI
Der Beitrag erschien zuerst im Standard am 18. Juni 2024

Teile das: