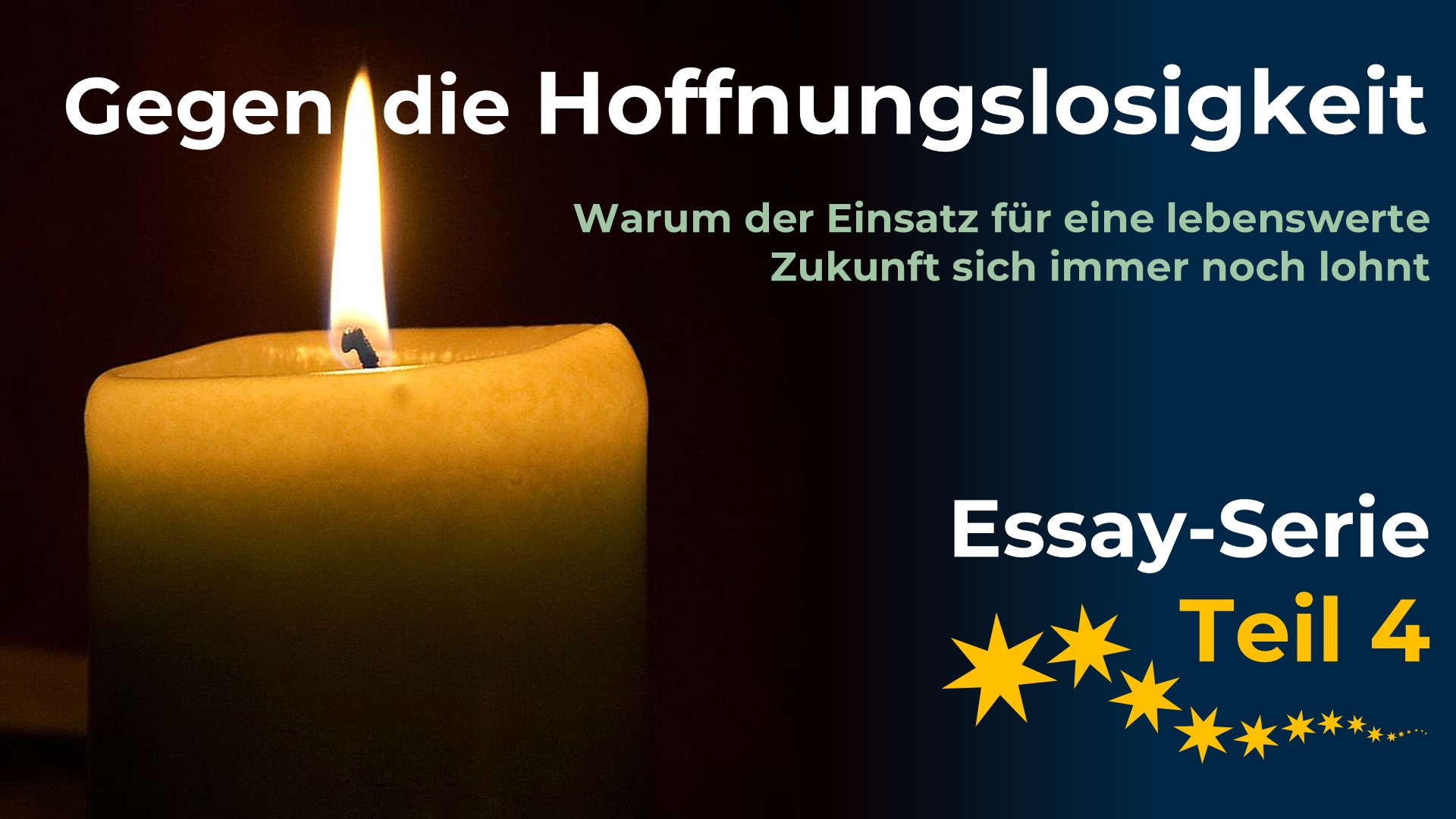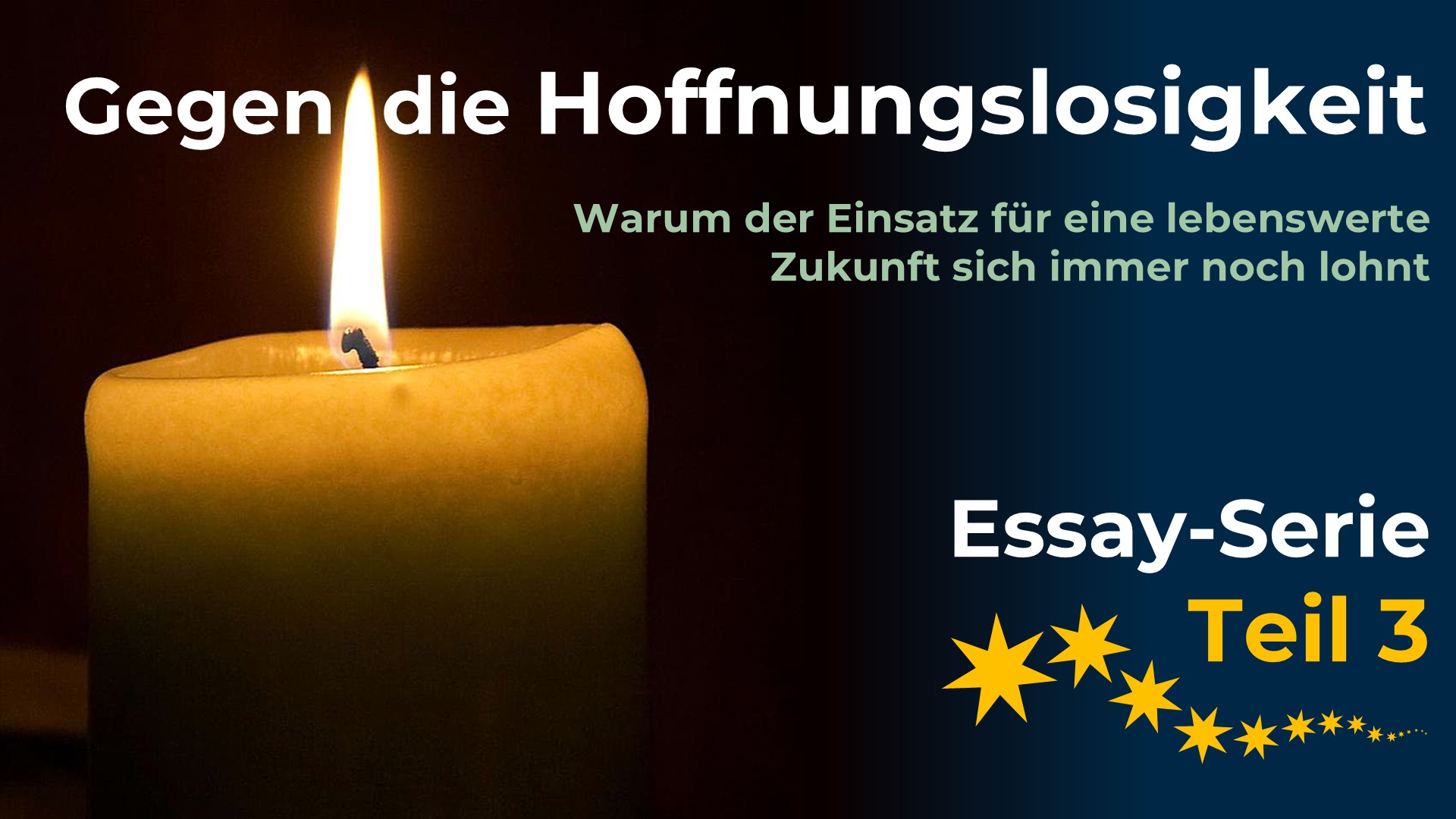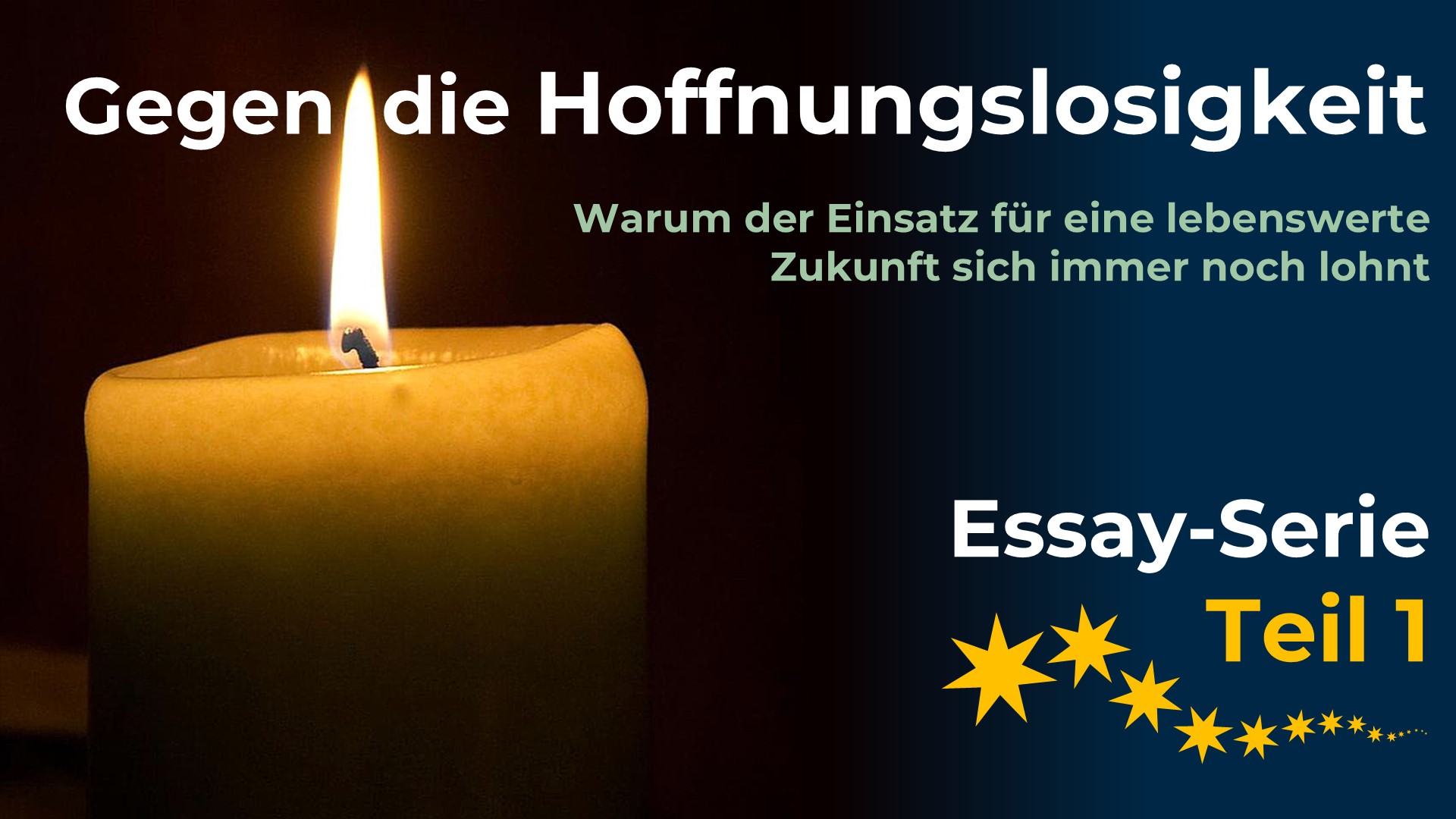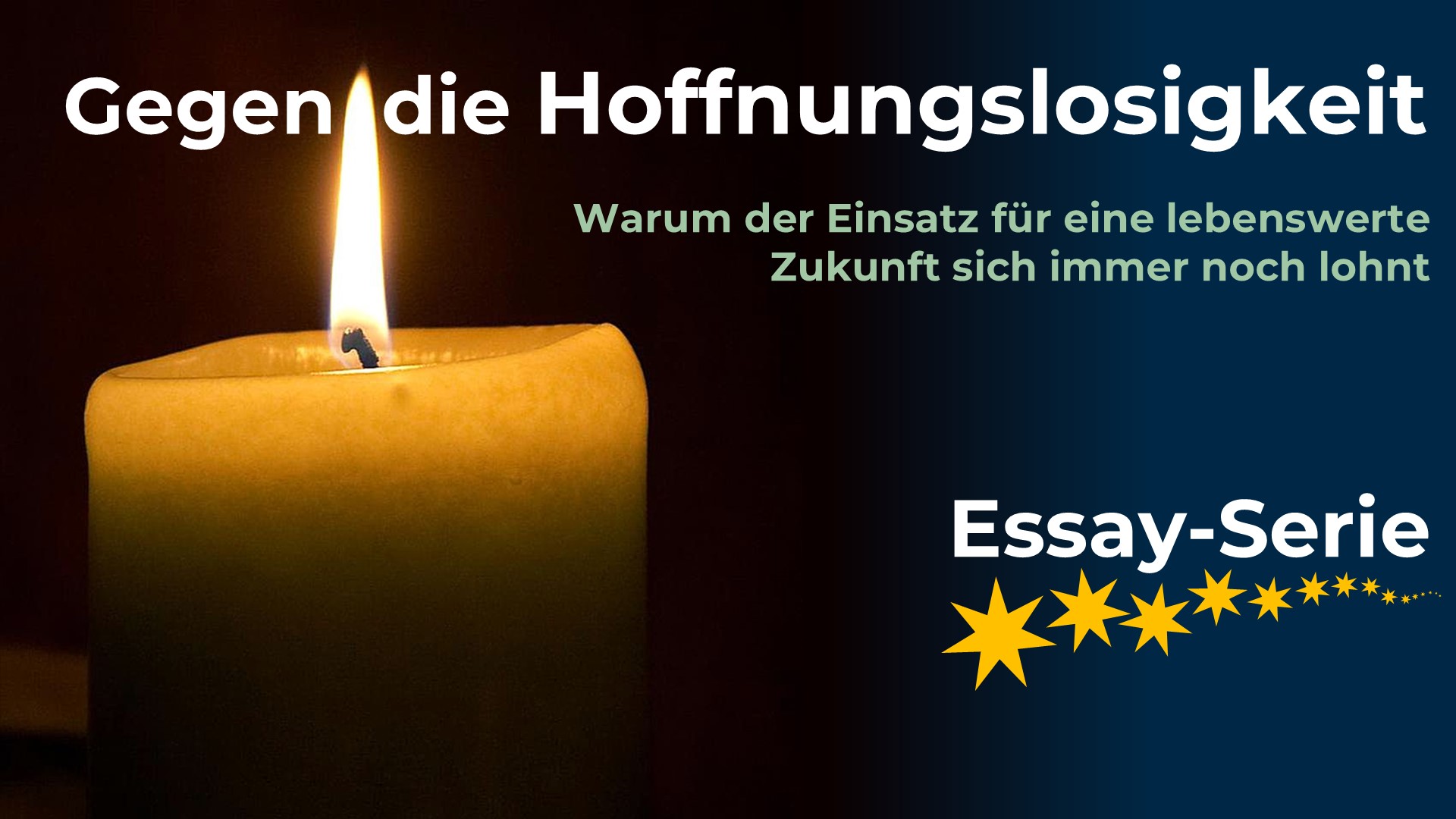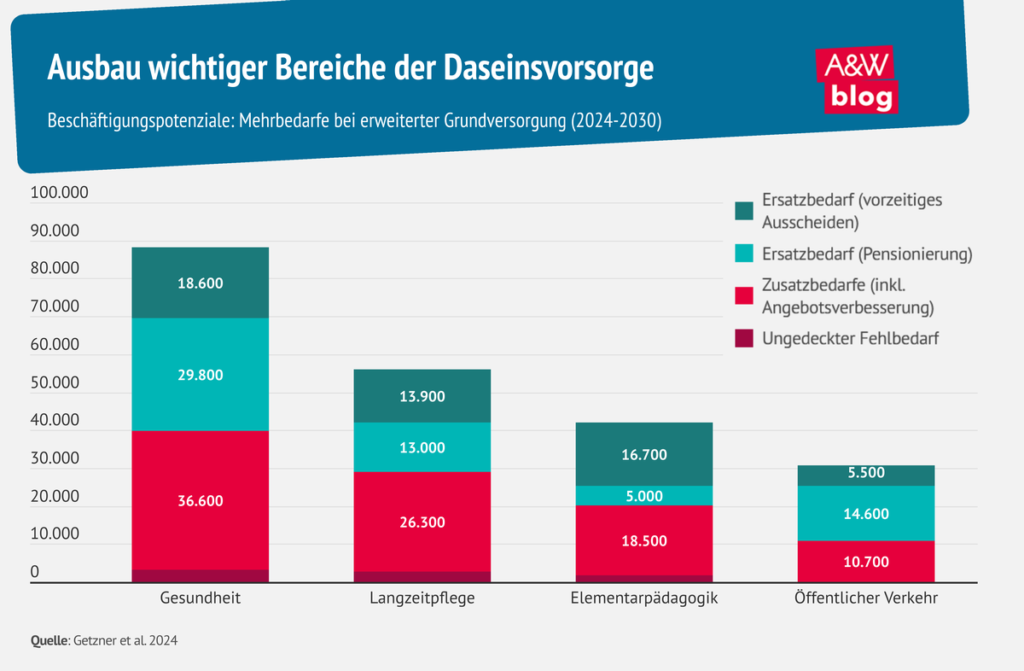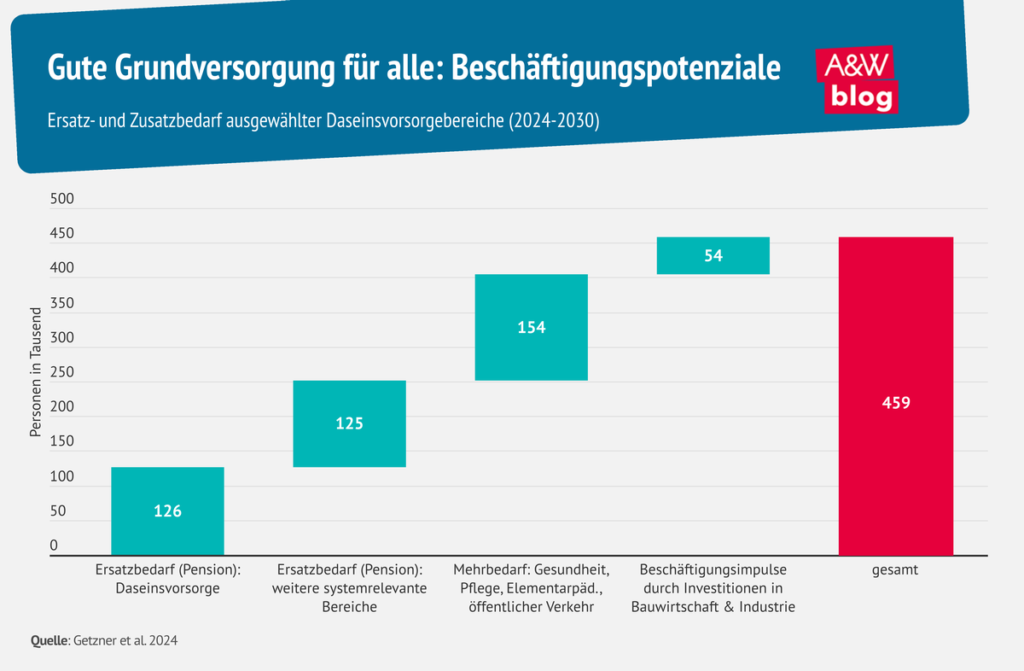Lesedauer 7 Minuten.
Sophie Elaine Wolf, AG Öffentlichkeitsarbeit
Das Jahr 2024, so scheint es, hat heftig auf die Bremse getreten, was das Engagement für den Klimaschutz betrifft: Trumps Wiederwahl, zahn- und zahlenlose internationale Verhandlungen zum Schutz der Biodiversität und des Klimas und nicht zuletzt Klimabewegungen, die sich zurückziehen oder gleich ganz auflösen. Resignation aufgrund fehlender sichtbarer Resultate und Frustration, weil nur Gegenwind kommt… sie ist verständlich. Anlass genug sich zu fragen, ob Aufgeben wirklich einen Option ist und welche Alternativen wir haben.
Aufgeben?
Individuell geben wir auf, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, unsere Kräfte erschöpft sind oder der Weg nicht weiter führt. Doch wann geben wir als Kollektiv auf? Das hängt ganz davon ab, wie das „wir“ definiert ist, und damit sind wir bei der Frage, wie mensch sich im Klimaaktivismus engagiert. Folgt man einer jüngeren Publikation, so lassen sich drei Blöcke identifizieren, die mobilisieren und antreiben: Das Gefühl der Wirksamkeit, Moral & Wut und Identifikationsmöglichkeiten mit anderen Personen in engagierten Gruppen.1 Eine Metastudie kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Sie identifiziert vier Kernmotivationen, dank derer Menschen sich besonders effektiv mobilisieren lassen: Eine gesellschaftliche Norm, in der Klimaaktivismus u. ä. positiv konnotiert ist (descriptive norms); die Sorge um die Klimakrise und deren Auswirkungen (negative effect); die Überzeugung, dass (politische) Maßnahmen Wirkung zeigen (outcome efficacy) und das Gefühl, dass mensch mit dem eigenen Tun Resultate erzielt (self-efficacy).2
Wir brauchen also persönliche Auslöser, die uns dazu bringen, Teil einer oder mehrerer Gruppen zu werden, die sich engagieren. Dann brauchen wir Erfolgserlebnisse auf persönlicher und kollektiver Ebene und eine anhaltenden Besorgnis.
An Letzterer mangelt es leider nicht, da sind wir uns sicher einig.
Bei den anderen sieht es offensichtlich schon ganz anders aus. Wir können schlussfolgern: Aufgeben passiert kollektiv dann, wenn die Wirkung ausbleibt, die Gruppenbindung bröckelt und die Wut der Verzweiflung weicht.
Weitermachen!
Nun hat das Kollektiv ein Gutes: Es ist in ständigem Wandel begriffen und setzt sich aus vielen Individuen zusammen. Das bedeutet, es gibt kein kollektives Aufgeben aller Klimabewegungen, kollektives Aufgeben ist schlicht keine Option. Solange wir leben besteht noch Hoffnung. Es besteht Hoffnung, weil es eine „letzte“ Generation in jeder Stadt, in jeder Nation, auf jedem Kontinent dieser Erde gibt. Es besteht noch Hoffnung, da 8 Milliarden Menschen nie einer Meinung sein werden und es immer neue Menschen geben wird, die die Herausforderung annehmen. Es besteht noch Hoffnung, weil Kinder diese Erde bevölkern: Sie sind die Zukunft. Sie sind unsere Hoffnung, unsere Verantwortung und sie können unser Antrieb sein.
Wut und Moral
Wem gehört die Welt? Die Letzte Generation mag aufgegeben haben unter dem Eindruck, dass die Welt den Reichen und Mächtigen gehört. Es erweckt den Anschein und das kann eine ganz schöne Wut erzeugen. Genauso wie es Wut erzeugen sollte, dass Jahrzehnte lang die Wissenschaft ignoriert worden ist und Einzelpersonen, Konzerne und Politik Desinformationskampagnen geführt haben, die der absurdeste Dystopie entsprungen scheinen. Doch tatsächlich gehört sie uns allen und damit vor allem jenen, die nach uns kommen: den Kindern. Und diese Kinder gehören einer Generation an, die anders ist, als die vorhergehenden: Sie wachsen auf in einer Zeit, in der die breite Bevölkerung rund um den Globus Bewusstsein um unsere Situation und den Zustand des Planeten erlangt hat – oder zumindest in der Lage wäre, dieses zu erlangen. Keine der Generationen, die zu diesem Zeitpunkt bestehen, kann noch behaupten, sie hätten nichts gewusst. Wir haben die Mittel und Wege uns zu informieren und damit das nötige Wissen.
Wissen ist Verantwortung
Verantwortung, nach unserem besten Wissen und Gewissen den Planeten für die zukünftigen Generationen in einen besseren Zustand zu versetzen, eine Welt zu hinterlassen, die noch Hoffnung darauf hat, dass auch die Menschen in ihr Platz haben. Die Zukunft gehört uns nicht, auch der Planet, den wir ausnutzen, gehört uns nicht, aber eines gehört uns: Unser Verstand und mit unserem Verstand kommt die Verantwortung. Wir wissen, dass wir so nicht weiter leben können. Wir wissen, dass wir für die Situation, in der sich der Planet befindet, verantwortlich sind, in jeder Hinsicht: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir tragen die Verantwortung, nicht allein jene, die Kinder „in die Welt gesetzt“ haben oder die Generationen vor uns, die sich willens oder durch mangelnde Information des Nicht-Handelns schuldig gemacht haben. Insbesondere das „wir“ jener Nationen, die im Verlauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte den Planeten über alle Maßen ausgenutzt und dabei jegliche Menschenrechte mit Füßen getreten haben, trägt die Verantwortung. Sie waren es, die sehenden Auges ihre Welt aus Ungerechtigkeiten errichtet haben, doch wir sind die Erben der historischen Verantwortung unserer „Wohlstandsgesellschaft“. Wir sind auch aktiv jene, die das System der Ausbeutung fortsetzen und darauf eine hanebüchene Zukunftsprojektion einer grünen Technologie-Zukunft aufbauen, in der immer weiter die Rohstoffe unseres gemeinsamen Planeten und Millionen von Menschenleben für den vermeintlichen Fortschritt einer kleinen privilegierten Minderheit ausgebeutet werden. Und so sehr wir persönlich auch verzichten, reduzieren oder anderweitig nach alternativen Modellen leben: Wir sind Teil einer Gesellschaft, in der wir es nicht vermeiden können, tagtäglich dem Planeten zu schaden.
Verantwortung
Wir sind Teil des Systems und haben damit die Verantwortung selbiges zu kritisieren und zu verändern. Es ist wichtig sich bewusst zu machen, dass Zukunft ein Luxus ist. Global gesehen ist der Zugang zu Bildung oder zu einem stabilen Gesundheitssystem ein Luxus, wie auch die Möglichkeit, Pläne nicht nur für morgen sondern auch für das kommende Jahr zu machen. Eigentlich aber zählen wir all das zu den Menschenrechten, die für alle ohne Unterscheidung gelten sollten.
Art. 25 (1) Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.
Wir haben es als Menschenrecht definiert, als ein Ideal, nach dem es zu streben gilt. Globale soziale Gerechtigkeit wäre das Resultat, würden wir die Menschenrechte auch tatsächlich umsetzen, auf der ganzen Welt. Es ist eine Utopie, vielleicht auch eine Mission Impossible. Doch das Streben nach Höherem, nach einer besseren Zukunft, die Projektion des scheinbar Unmöglichen aber Vorstellbaren, kurz unsere Fantasie ist es, die uns zu Menschen macht. Denn wenn wir an die Menschenrechte, an Gleichberechtigung, an das Recht auf Zukunft und an den Wert jedes einzelnen Lebewesens glauben, dann können wir nicht anders, als uns unserer Verantwortung zu stellen.
Verantwortung klingt nach Zwang und bekanntlich kommt mit Zwang Widerstand und mit Widerstand Energieverlust. Für manche mag die Perspektive der Verantwortung daher kontraproduktiv wirken. Doch schauen wir genauer hin, ist Verantwortung eigentlich das Instrument schlechthin aus der Trickkiste des Mensch-Seins: Verantwortung ist das Ende der Belanglosigkeit und des Egoismus. Mit der Verantwortung kommen Inhalte und Werte, Verantwortung stellt uns das Ziel vor Augen. Sie lässt uns den inneren Schweinehund überwinden, die letzte Meile gehen, die letzten Reserven abrufen. Verantwortung macht uns alle zu Held:innen.
Held:innen
Wir wollen also Gutes tun – nur, Was und Wie? Erster Schritt: Erkenne dich selbst. Wir kennen uns am besten (oder so hoffen wir) und selbst wenn wir etwas übersehen: Unser ganz persönliches Gewissen, dass mit offenen Augen in die Zukunft schaut, weiß, was wir können, wie viel Kraft wir haben und wie wir diese immer wieder neu schöpfen können. Jede:r kann sich auf ganz eigene Art und Weise, nach den eigenen Talenten und Möglichkeiten engagieren. Für eine Zukunft aktiv werden, die uns nicht gehört, aber eine, die wir ermöglichen müssen. Angefangen bei unserer Haltung und unseren Werten, die wir jeden Tag in die Welt hinaustragen, die wir unseren Kindern, unserer Familie, unserem Umfeld vermitteln.
Nach unserem Gewissen zu handeln bedeutet dabei nicht, die Dinge im kleinen Stil zu machen, sondern ehrlich zu sich selbst zu sein: Was kann ich wirklich tun und kann ich mehr tun? Wissen schafft Verantwortung und so sollten Wissenschaftler:innen, die faktenbasierte Kritik am Status quo und einer unsäglich trägen oder gleich unverantwortlich blinden Politik üben, nicht abgestraft werden. Sondern sie sollten diese Verantwortung tatsächlich – wie in einem hippokratischen Eid – wahrnehmen, ihr Wissen verantwortungsvoll im Sinne des Wohlergehens der globalen Bevölkerung verbreiten. Aber auch Talent schafft Verantwortung: Manche Menschen können mobilisieren, andere organisieren oder diplomatisch vermitteln, wieder andere bringen ihre Netzwerk in die Klimabewegung ein. Ganz entscheidend kommt die Verantwortung mit dem Bewusstsein unseres Privilegs: Die meisten von uns können sich engagieren, ohne um Leib und Leben zu fürchten. Mittlerweile gibt es auch in den westlichen Rechtsstaaten Fälle von absurden Strafen für friedlichen Aktivismus (bspw. Just Stop Oil)3, aber kein System kann in irgendeiner Form rechtfertigen, dass Menschen rund um den Globus für ihren Aktivismus sterben müssen, und dennoch passiert es. Allein 2023 wurden einem Bericht zufolge 169 Menschen aufgrund ihres Engagements gegen die Klimakrise getötet.4 Sein wir also aktiv und bleiben wir aktiv, denn das Recht auf Protest ist eines, das mit allen Mitteln verteidigt werden muss: Für uns und für alle Menschen auf dieser Erde.
Der Treibstoff für unseren Motor
Sich ein erstes Mal zu engagieren in der Klimabewegung ist der einfache Teil der Übung. Die Schwierigkeit jedes freiwilligen – unentgeltlichen – Engagements liegt darin begründet, dass dieses zum Rest unseres Lebens passen muss: Wir müssen Zeit dafür finden oder dafür schaffen und das tun wir nur so lange keine anderen Aspekte unseres Lebens größere Priorität erlangen. Aktivismus kann langfristig nicht aus einer Mode heraus betrieben werden oder gespeist werden aus Gefühlen wie Angst oder Wut. Negative Gefühle sind zwar mitunter mächtige Orkane, reiben aber genauso auf und haben einen enormen emotionalen Energieverbrauch. Wenn wir es ernst meinen mit unserem Engagement, müssen wir uns also auch dahingehend befragen, wie wir unsere Akkus aufladen.
Antrieb und Kraft schöpfen Menschen aus vielen verschiedenen Dingen und dort sollte jede:r ansetzen, ganz bewusst und individuell. Ein essentielles Element mögen Übungen fürs innere Auge sein: Von den großen, globalen Zielen immer wieder auf das Detail und die „kleinen“ Erfolge blicken und sich bewusst machen, dass auch das große Ganze nur aus einzelnen Elementen zusammengesetzt ist. So etwa mag die Gewissheit helfen, dass es für manche Entscheidungsträger:innen in politisch relevanten Positionen essentiell ist, die Rückendeckung durch die Bevölkerung, Bewegungen und NGOs auch tatsächlich zu spüren. Oder wir freuen uns einfach über eine gelungene Veranstaltung, ein positives Feedback zu einer Aktion oder darüber, dass diese in der Tageszeitung erwähnt wird. Und dann wieder sind da die großen Ideen, die Utopien einer anderen Zukunft, die uns anspornen können. Besonders, wenn nicht wir allein im stillen Kämmerlein davon träumen, sondern wenn diese von global Playern gezeichnet werden. Erst im September diesen Jahres hat die UN, ähnlich den Menschenrechten, die Declaration on Future Generations verabschiedet, die eine andere Welt entwirft.5 Eine Welt, die utopisch erscheinen mag, die uns jedoch an unsere Menschlichkeit erinnert und klare Worte findet. Auch ein so symbolisch deklariertes, gemeinsames, globales Ziel kann uns motivieren, jeden Tag aufs Neue die Kraft aufzubringen, weiter zu machen.
Wenn mensch persönlich ganz eigene Wege der Regeneration findet, gibt es auf kollektiver Ebene einen entscheidenden Faktor: die Wertschätzung. Gerade bottom-up Bewegungen charakterisieren sich durch eine nicht hierarchische Organisationsstruktur, die ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Für sie ist es von enormer Relevanz, dass die Mitglieder sich untereinander Wertschätzung entgegenbringen auf allen Ebenen: In den Meetings, in der Aufgabenverteilung, dem Mitspracherecht bis hin zu jenen Momenten, in denen Erfolge zelebriert werden. Wenn mensch sich in der Gruppe wertvoll fühlt, dann schöpfen wir daraus die Kraft, weiter zu machen und gemeinsam neue Herausforderungen anzugehen.
Die Zukunft der Anderen
Von dem ersten Kennenlernen und dem großen Enthusiasmus bis hin zur Ernüchterung und der Frage, wie sich die Leidenschaft erhalten kann: Das Engagement in der Klimabewegung ist eine Art Beziehung und als solche braucht es Zuwendung und Wertschätzung und eine Perspektive. Sind diese gegeben, haben wir keinen Grund, aufzugeben, im Gegenteil: Dann ist Liebe die sich selbst erneuernde Energiequelle, die uns kollektiv die Kraft verleiht, die Welt zu verändern. Gebt also nicht auf, sondern übernehmt Verantwortung: Für das was ihr liebt und für die Menschen, die ihr liebt. Übernehmen wir Verantwortung für die Zukunft, die nicht uns gehört, deren Fundamente aber von uns gelegt werden. Übernehmen wir endlich Verantwortung für die Zukunft der Anderen.
Folge uns:







Teile das: