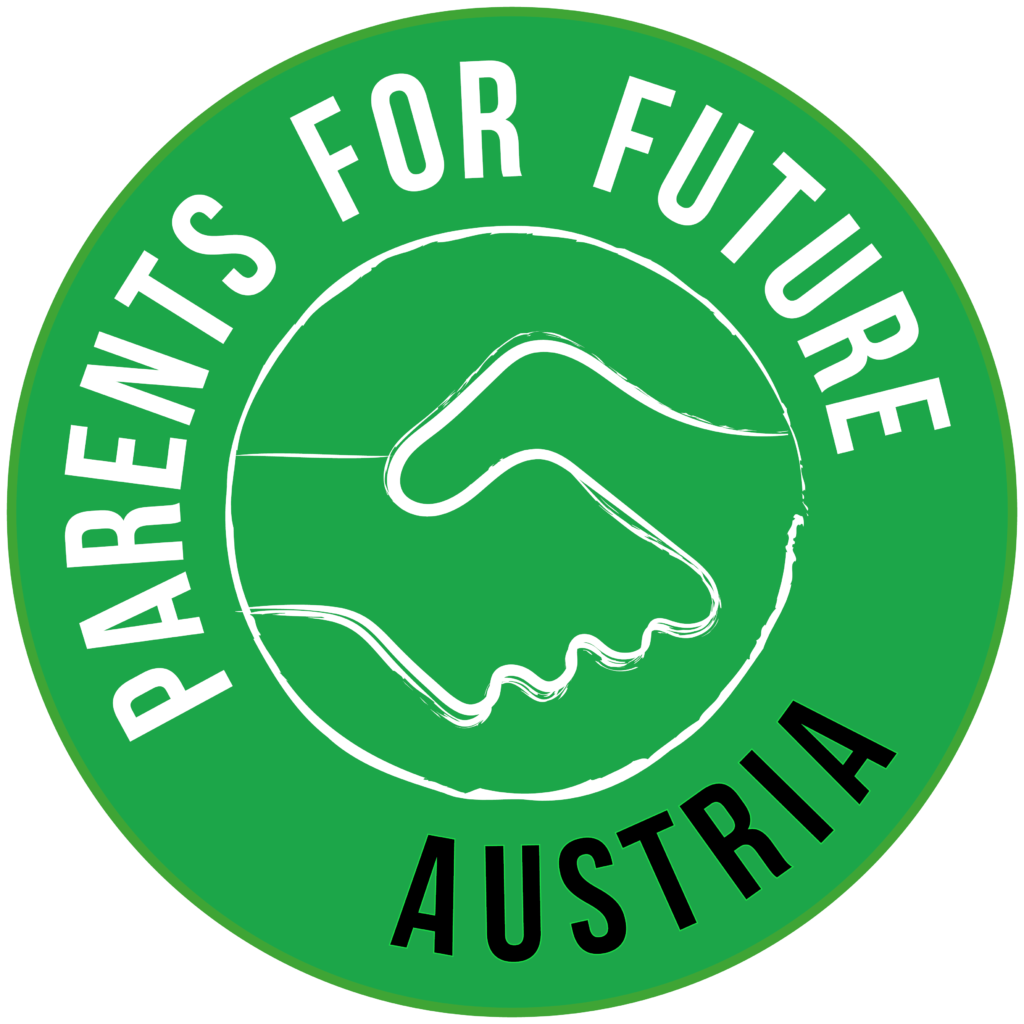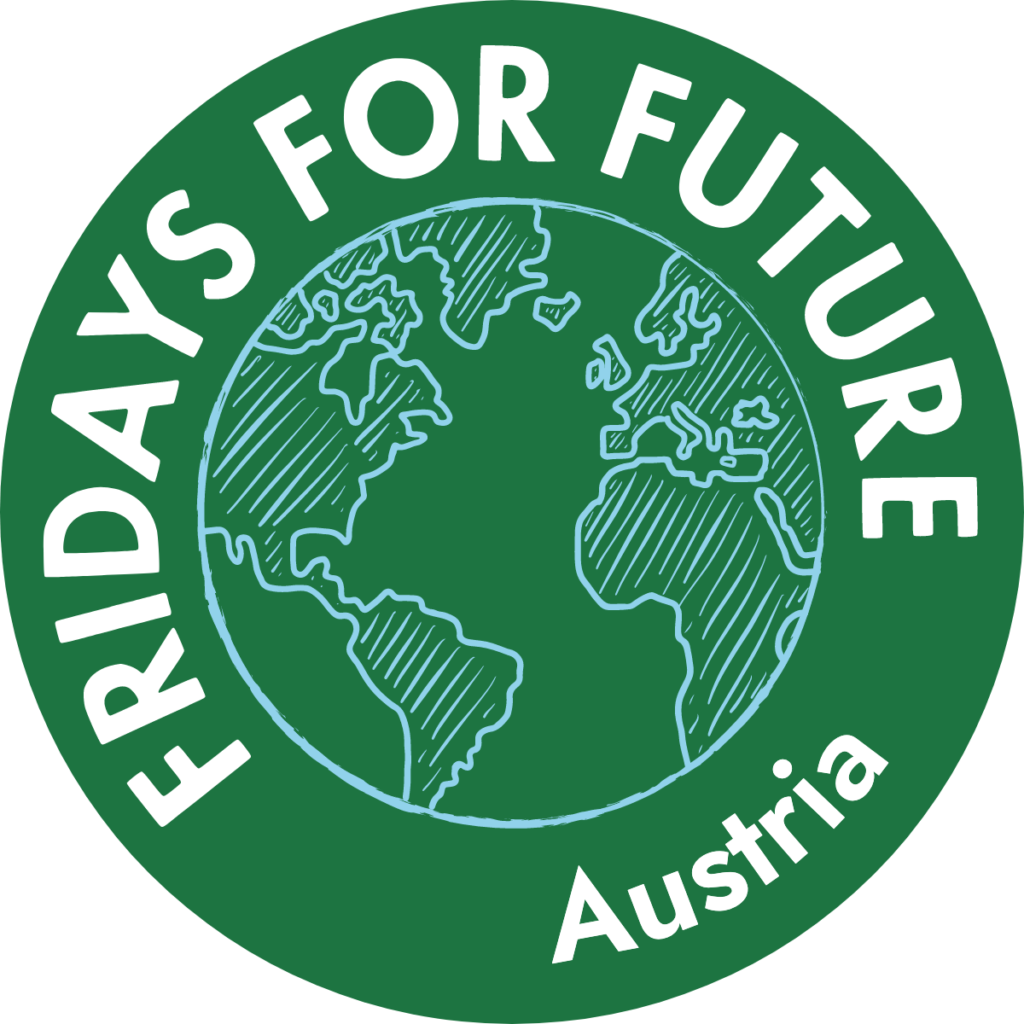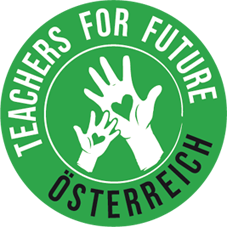Die Scientists for Future Österreich und Wissenschaftler:innen ihres Fachkollegiums begrüßen den Vorstoß der Landeshauptleute Peter Kaiser und Michael Ludwig sowie die Bemühungen von Bundesministerin Leonore Gewessler um die EU-Renaturierungsverordnung ausdrücklich.
Wir appellieren dringend, diesen vielversprechenden Weg weiterzugehen und diese Woche gemeinsam ein österreichisches „Ja“ zur Renaturierungsverordnung zu ermöglichen!
Sie haben damit die Chance, ein Kernanliegen der Bürger:innen in Österreich und der Europäischen Union aufzugreifen, die sich mehrheitlich um den Naturverlust sorgen: Drei Viertel der Bürger:innen fordern verbindliche Ziele zur Wiederherstellung der Natur von der Politik1.
Warum brauchen wir die Verordnung?
- Wiederherstellungsmaßnahmen schaffen CO2-Senken und stellen (z.B. Im Bereich von Flussrenaturierungen) Anpassungen an die Klimakrise dar2. Wie dringend solche Maßnahmen sind, zeigen die Extremwetterereignisse unter anderem im Burgenland und der Steiermark in den letzten Tagen.
- Ernährungssicherheit ist nur möglich, wenn Ökosystemleistungen z.B. durch Bestäuber sichergestellt sind; deshalb ist die Verordnung keine Bedrohung, sondern ein wichtiger Beitrag zur Ernährungssicherheit. Zudem räumt die aktuelle Fassung der Verordnung für den als äußert unwahrscheinlich eingestuften Fall, dass die Ernährungssicherheit gefährdet würde, die Möglichkeit der vorübergehenden Aussetzung der Anwendung der Verordnung ein3.
- Die Wirtschaft hängt von einer funktionsfähigen Natur ab4. Eine breite Allianz aus Unternehmer:innen hat die EU-Ratspräsidentschaft daher in einem Brief aufgefordert, eine Zustimmung zur Verordnung sicherzustellen5.
- Die Finanzierung von Wiederherstellungsprojekten profitiert in Österreich schon jetzt teilweise von EU-Fonds. Für die jährlichen Kosten der in der Verordnung angestrebten zusätzlichen Wiederherstellung sind neben den – bereits bestehenden – Möglichkeiten durch den Finanzrahmen der EU sowie Förderprogramme, neue Finanzierungen vorgesehen6. Zudem ist einer Wirkungsanalyse der EU-Kommission zufolge der Nutzen der Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme in Österreich 12-mal höher als deren Kosten7. Das Nichthandeln belastet das österreichische Staatsbudget hingegen bereits jetzt mit mehreren Milliarden Euro pro Jahr8.
- Ökosysteme halten sich nicht an Ländergrenzen. Maßnahmen und Gesetze innerhalb Österreichs werden nicht ausreichen, um die Lebensqualität der Menschen in Österreich und der EU zukünftig zu sichern. Die Verordnung soll garantieren, dass alle EU-Mitgliedstaaten ihren Beitrag zu einer gemeinsamen Herausforderung leisten.
- Europa hat sich immer wieder als Vorreiter in Sachen Klimaschutz und Klimaanpassung präsentiert. Die deutlichen Rückschritte in der Umsetzung des Europäischen Green Deals stellen diese Rolle in Frage9. Die Renaturierungsverordnung würde wesentlich dazu beitragen, unterzeichneten globalen Verträgen gerecht zu werden (UN-Kinderrechtskonvention, Globaler Biodiversitätsrahmen von Kunming-Montreal, Pariser Klimaschutzabkommen). Sie ist eine große Chance für Österreich und die EU, sich international sichtbar für das Wohl von Menschen, Wirtschaft und Natur einzusetzen.
Die Stimmen der Wissenschaftler:innen des Fachkollegiums für die Renaturierungsverordnung
Obwohl wir der Erde schon zahlreiche Schäden zugefügt haben, versorgt sie uns (im globalen Norden) noch immer mit allem, was wir brauchen. Genau dies riskieren wir aber in zunehmendem Maße. Die Renaturierungsverordnung bietet die Chance, einen Teil der Schäden rückgängig zu machen, mindestens aber die Situation nicht noch weiter zu verschlimmern. Diese Chance nicht zu ergreifen, wäre fahrlässig und verantwortungslos. Assoc. Prof. Dr. Kirsten von Elverfeldt
Für Menschen, Tiere, Pflanzen und auch für Pilze ist das NRL zukunftsweisend und unbedingt nötig. Der globale Marktwert von Pilzen wird auf 54,57 Billionen USD geschätzt10. Pilze haben also enormen ökonomischen Wert und Einfluss auf die globale Wirtschaft. Die monetäre Bewertung von Pilzprodukten, Pilzen und deren Rolle im Ökosystem sollte daher auch entscheidend für politische Maßnahmen zur Erhaltung und Verwertung dieser am globalen Markt zunehmend präsenten Ressource sind. Der enorme finanzielle Wert von Pilzen untermauert das Argument, dass Landschaften erhalten werden müssen, um die darin enthaltenen natürlichen Ressourcen zu schützen. Bisher wurde nur ein kleiner Teil der Pilze in der Natur entdeckt. Somit sind Milliarden von Dollar an Pilzressourcen noch unentdeckt oder verloren, wenn ihre Lebensräume zerstört werden. Daher ist die Zustimmung zum Nature Restoration Law eine simple Notwendigkeit um eine lebenswerte Zukunft für alle zu sichern. Prof. Mag. Dr. Irmgard Krisai-Greilhuber
Das EU-Renaturierungsgesetz ist eine zentrale Weichenstellung für die Umsetzung naturbasierter Lösungen, welche nicht nur dem Schutz vor klimabedingten Risiken wie Hochwasser dienen, sondern gleichzeitig auch Biodiversität fördern und durch zusätzliche Kohlenstoffspeicherung zur Minderung des Klimawandels beitragen. Nicht die Unterstützung dieses Gesetzes gefährdet Österreichs Lebensgrundlagen, sondern ein weiter wie bisher im sorglosen Umgang mit der Natur. Dr. Thomas Schinko
Die SPÖ hat die einmalige Chance zu zeigen, dass ihr Umwelt- und Klimaschutz auch in der Umsetzung wichtiger ist als der ÖVP. Umweltpolitischer Taktierer bei der EU-Wahl gewesen zu sein wird bei der Nationalratswahl nicht reichen. Assoc. Prof. Mag. Dr. Reinhard Steurer
Für unsere Kinder haben wir keine andere Wahl! Prof. Dr. Michael Wagreich
So tragisch die aktuellen Hochwasser im Burgenland und der Steiermark für die Betroffenen auch sind, überraschend sind diese Extremwetterereignisse nicht. Die Klimafolgenforschung warnt seit Jahrzehnten vor häufigeren und intensiveren Niederschlägen und deren mitunter lebensbedrohlichen Folgen, benennt die Ursachen und zeigt der Politik konkrete Handlungsoptionen auf1112. Ein Ja zur EU-Renaturierungsverordnung wird der Bevölkerung demonstrieren, wer in Österreich politisch verantwortlich handelt. Das heißt, wer die Klimakrise und die Sorgen der Menschen um eine intakte Natur und ihre Gesundheit ernst nimmt und komplexen Fragen mit Sachverstand begegnet. Mag.rer.nat. Dr. phil. Ulli Weisz
Im Jahr 1777 erschien in der Zeitschrift „Neue Mannigfaltigkeiten“ ein Streitgespräch zwischeneinem Bach und einem Kanal. Der Kanal lobte seine wirtschaftliche Bedeutung, während derBach seine Ökosystemleistungen hervorhebt, wenn er dem Kanal widerspricht: „Die Krümmungen meines Laufs, die du so sehr verachtest, dienen dazu, die Erfrischung meines Wassers über einen größren Theil des Bodens zu verbreiten. […] Denn dein in tiefenSeitenwänden eingeschlossenes oder über Thäler gehobenes Wasser, läuft über, wird unnütze Last der Felder und ist bloß der Sklavenarbeit, vergängliche Güter zu tragen, behülflich; abermein Fluß beschenkt die Wiesen mit unveränderlicher Fruchtbarkeit.“13 Als Umwelthistorikerin finde ich es erstaunlich, wie lange diese Leistungen schon bekannt sind, noch mehr aber verwundert es mich, dass immer noch diskutiert wird, ob wir ein Renaturierungsgesetz brauchen – 247 Jahre Nachdenken über Ökosystemleistungen sollteneigentlich genug sein. Univ.-Prof. (i.R.) Ing. Dr. phil. Dr. h.c. Verena Winiwarter
Ein Ja zur Renaturierungsverordnung ist ein Ja zu einem lebenswerten Österreich, einemÖsterreich, in demevidenzbasierte und sozial gerechte Politik für das Wohl der Bürger:innen des Landes Sorge trägt – ganz im Auftrag der Wähler:innenschaft!
Die Scientists for Future Österreich gemeinsam mit Wissenschaftler:innen ihres Fachkollegiums:
Dipl.-Ing. Dr.nat.techn. Benedikt Becsi University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna; Assoc. Prof. Dr. Kirsten von Elverfeldt; Assoc. Prof. Dr. Karlheinz Erb Director Institute of Social Ecology (SEC) University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna; Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Irmgard Krisai-Greilhuber; Dr. Thomas Schinko, Senior Research Scholar and Research Group Leader (Equity & Justice Research Group), International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria; Dipl.-Ing. Dr. Gunter Sperka ehem. Klimakoordinator des Landes Salzburg; Assoc. Prof. Mag. Dr. Reinhard Steurer University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna; Prof. Dr. Michael Wagreich Department of Geology Faculty of Earth Sciences, Geography and Astronomy, University of Vienna; Mag.rer.nat. Dr. phil. Ulli Weisz Univ.-Prof. (i.R.) Ing. Dr. phil. Dr. h.c. Verena Winiwarter.
- Savanta 2024: „Citizens’ perceptions on nature and biodiversity in the EU. Survey Results“, https://www.restorenature.eu/File/Citizens-survey-nature-biodiversity-NRL-EU.pdf und WWF 2024: „WWF-Umfrage: Große Mehrheit besorgt über Naturverlust“, https://www.wwf.at/wwf-umfrage-grosse-mehrheit-besorgt-ueber-naturverlust/ ↩︎
- IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 184 pp., doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647 ↩︎
- Siehe sowohl Punkt (88) der Verordnung als auch Art. 27 zur „Vorübergehenden Aussetzung“. ↩︎
- Corporate Leaders Group 2024: „Business Networks‘ Letter on the Nature Restoration Law“, https://www.corporateleadersgroup.com/files/clg_europe_led_letter_on_nature_restoration_-_may_2023.pdf ↩︎
- euobserver 2024: „Businesses join forces to call on EU to save nature restoration law“, https://euobserver.com/green-economy/arafdc52df ↩︎
- Umweltbundesamt: „Ökonomischer Nutzen“, https://www.umweltbundesamt.at/naturschutz/nature-restoration-regulation/oekonomischer-nutzen ↩︎
- EU 2023: „Impact assessment study to support the development of legally binding EU nature restoration targets. Final Report“, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/db3e5d55-310c-11ee-946a-01aa75ed71a1 ↩︎
- WIFO 2024: „Policy Brief: Budgetäre Kosten und Risiken durch klimapolitisches Nichthandeln und Klimarisiken“, https://www.wifo.ac.at/publication/49048/ ↩︎
- Society for Conservation Biology et al. 2024: „Expression of Concern by Scientific associations: Rollback of EU environmental legislation and policies jeopardises the future of EU citizens“, https://zenodo.org/records/11493585. ↩︎
- Allen Grace T. Niego A.G.T. et al. (2023) The contribution of fungi to the global economy. Fungal Diversity 121: 95–137. https://doi.org/10.1007/s13225-023-00520-9 ↩︎
- IPCC 2023 (wie hier Fussnote 2). ↩︎
- Romanello, M. et al. The 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change: the imperative for a health-centred response in a world facing irreversible harms. The Lancet 402, 2346–2394 (2023). DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01859-7. ↩︎
- Der Kanal und der Bach. Ein Traum, aus dem Englischen, in: Neue Mannigfaltigkeiten 4 (1777), S. 33–37. ↩︎

Teile das: