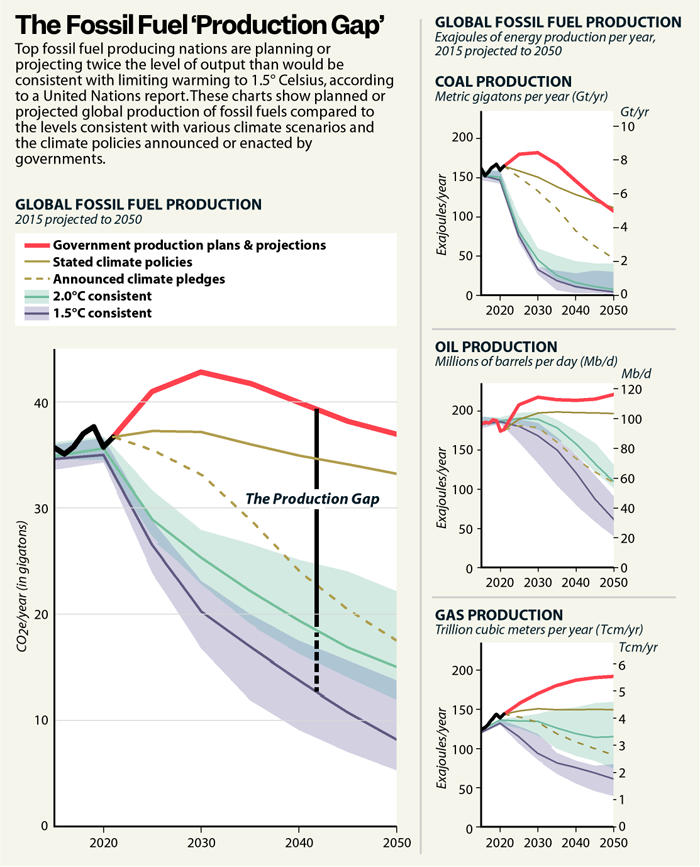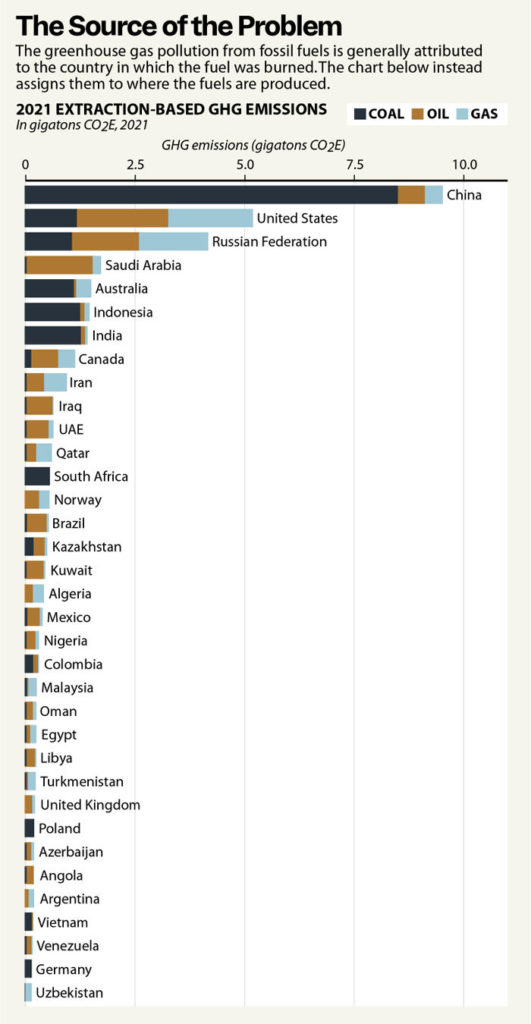Die Verschlechterung von ausgedehnten, oft weitläufigen natürlichen Weidelandschaften durch Überlastung, missbräuchliche Nutzung, Klimawandel und Biodiversitätsverlust stellt eine ernsthafte Bedrohung für die globale Nahrungsmittelversorgung und das Überleben von Milliarden von Menschen dar, warnen die Vereinten Nationen in einem umfassenden Bericht vom Mai 2024.
Bis zu 50 % der globalen Weideflächen sind degradiert, sage die Autor:innen des Global Land Outlook Thematic Report on Rangelands and Pastoralists, der in Ulanbaatar (Mongolei) von der UN Wüstenkonvention (UNCCD) vorgestellt wurde. Zu den Symptomen dieser Verschlechterung gehören verminderte Bodenfruchtbarkeit und Nährstoffversorgung, Erosion, Versalzung, Alkalisierung und Bodenverdichtung, die das Pflanzenwachstum hemmt. Dies führt unter anderem zu Trockenheit, Niederschlagsschwankungen und dem Biodiversitätsverlust über und unter der Erde.
Ursachen sind vornehmlich die Umwidmung von Weideland in Ackerland und andere Landnutzungsänderungen aufgrund von Bevölkerungswachstums und Verstädterung, steigendem Bedarf an Nahrungsmitteln, Faserprodukten und Biotreibstoffen; Überweidung; Aufgabe von Weideflächen und durch die Politik vorangetriebene Übernutzung der Flächen.
Die Bedeutung von Weideland
In die Kategorie „Weideland“ fallen natürliche Graslandschaften, die von Vieh und Wildtieren als Weide- und Futterfläche genutzt werden, so auch Savannen, Buschland, Feuchtgebiete, Tundra und Wüsten.
Zusammengenommen machen diese Flächen 54 % der gesamten Landbedeckung aus, liefern ein Sechstel der weltweiten Nahrungsmittelproduktion und stellen fast ein Drittel des Kohlenstoffspeichers der Erde dar.
„Die Umgestaltung alter Weideflächen geschieht in aller Stille und ruft kaum öffentliche Reaktionen hervor“, sagt UNCCD-Exekutivsekretär Ibrahim Thiaw.
„Obwohl sie weltweit schätzungsweise eine halbe Milliarde Menschen ausmachen, werden die Hirtengemeinschaften häufig übersehen, haben kein Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen, die sich direkt auf ihren Lebensunterhalt auswirken, werden an den Rand gedrängt und sogar oft als Außenseiter:innen in ihrem eigenen Land betrachtet.“
Insgesamt sind zwei Miliarden Menschen – Kleinhirt:innen, Viehzüchter:innen und Landwirt:innen – oft vulnerabel und ausgegrenzt – sind weltweit von intakten Weideflächen abhängig.
Der Bericht unterstreicht, dass paradoxerweise gerade die Bemühungen zur Erhöhung von Ernährungssicherheit und Produktivität durch Umwandlung von Weideflächen in Ackerland in den meisten trockenen Regionen zu einer Verschlechterung der Bodenqualität und zu geringeren landwirtschaftlichen Erträgen geführt haben. Weiter werden „schwache und ineffektive Regierungsführung“, „schlecht umgesetzte Politiken und Vorschriften“ und „fehlende Investitionen in Weidelandgemeinschaften und nachhaltige Produktionsmodelle“ als Gründe für die Zerstörung von Weideland genannt.
Laut der mehr als 60 Experten aus über 40 Ländern liegen die bisherige Schätzung der weltweiten Degradierung von Weideland – 25 % – deutlich zu niedrig und könnten tatsächlichen bis zu 50 % betragen.
Der Nutzen von Weideland und seine Funktionsweise werden oft schlecht verstanden, und Mangel an verlässlichen Daten verhindert größtenteils die nachhaltige Bewirtschaftung dieser für Nahrungsmittelversorgung und Klimaregulierung immens wertvollen Flächen.
Wichtigste Empfehlung: das Hirtenwesen schützen
Der Bericht stellt einen innovativen Ansatz vor, der es politischen Entscheidungsträger:innen ermöglichen würde, Weideland zu sichern, wiederherzustellen und zu verwalten.
Der neue Ansatz stützt sich auf Erfahrungen, die in Fallstudien aus fast allen Regionen der Welt zusammengetragen wurden, und zieht wichtige Lehren aus Erfolgen und Misserfolgen in der Weidewirtschaft.
Eine zentrale Empfehlung lautet: Schutz des Hirtenwesens, einer Jahrtausende alten mobilen Lebensform, die sich auf die weidebasierte Zucht von Schafen, Ziegen, Rindern, Pferden, Kamelen, Yaks, Lamas und anderen domestizierten Pflanzenfressern sowie halbdomestizierten Arten wie Bisons und Rentieren konzentriert.
Die weltweit am stärksten von der Verschlechterung der Weideflächen betroffenen Gebiete, in absteigender Reihenfolge:
Zentralasien, China, Mongolei Privatisierung und Agrarindustrialisierung hat die Hirt:innen von unzureichenden natürlichen Ressourcen abhängig gemacht, mit dem Resultat einer weit verbreiteten Degradation. Die allmähliche Wiederherstellung der traditionellen, gemeinschaftsbasierten Weidewirtschaft führt zu deutlichen Fortschritten bei der nachhaltigen Bewirtschaftung.
Nordafrika und Naher Osten Die Auswirkungen der Klimakrise in einer der trockensten Regionen der Welt treiben die Hirt:innen in die Armut durch Verschlechterung von lebensnotwendigen Weideflächen. Die Modernisieriung traditioneller Einrichtungen wie Agdals (Futterreservoirs, die zwischenzeitliche Regeneration natürlicher Ressourcen ermöglichen) und unterstützende Maßnahmen verbessern die Bewirtschaftung der Weideflächen.
Sahel und Westafrika Konflikte, Machtverhältnisse und Grenzfragen haben die Mobilität der Viehherden unterbrochen und zu einer Verschlechterung der Weideflächen geführt. Einheitlichere Maßnahmen, Anerkennung der Rechte von Viehzüchter:innen und grenzüberschreitende Vereinbarungen helfen, die essentielle Mobilität der Viehzüchter:innen wiederherzustellen.
Südamerika Klimakrise, Entwaldung (insb. durch industrialisierten Landwirtschaft und Bergbau) sowie die Umwidmung sind in Südamerika die Hauptursachen für die Verschlechterung der Weideflächen. Multifunktionalität und Vielfalt in Weidesystemen sind daher der Schlüssel zur Wiederherstellung einiger der bedeutendsten Weideländer der Welt (etwa Pampa, Cerrado– und Caatinga-Savannen und die Puna in den peruanischen Anden.).
Ostafrika Migration und Zwangsumsiedlung bedingt durch konkurrierender Landnutzungen (Jagd, Tourismus usw.) vertreiben die Hirt:innen, was die Degradierung der Weideflächen zur Folge hat. Von Frauen geführte Initiativen und verbesserte Landrechte sichern den Lebensunterhalt der Hirt:innen, schützen die Biodiversität und sichern die Ökosystemleistungen von Weideland.
Nordamerika Die Zerstörung traditioneller Graslandschaften und trockener Weideflächen bedroht die Artenvielfalt typischer nordamerikanischer Ökosysteme wie der Hochgrasprärien oder der südlichen Wüsten. Die Einbeziehung der indigenen Bevölkerung in die Bewirtschaftung von Weideland ist ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der historischen Landschaften.
Europa Die Förderung industrielle Landwirtschaft gegenüber der Weidewirtschaft sowie falsche Anreize führen zur Aufgabe und Verschlechterung von Weideland und anderer offener Ökosysteme. Doch zugleich können politische und wirtschaftliche Unterstützung, einschließlich rechtlicher Anerkennung und Differenzierung, zur Trendwende beitragen und damit beispielsweise zunehmende Häufigkeit und Intensität von Waldbränden und den Klimawandel eindämmen.
Südafrika und Australien Aufforstung, Bergbau und die Umwandlung von Weideflächen in andere Nutzungen führen zu einer Verschlechterung und zum Verlust von Weideflächen. Die gemeinsame Schaffung von Wissen durch Erzeuger und Forscher sowie die Achtung und Nutzung des traditionellen Wissens indigener Gemeinschaften eröffnen neue Wege zur Wiederherstellung und zum Schutz von Weideland.
Paradigmenwechsel
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass ein Paradigmenwechsel in der Bewirtschaftung auf allen Ebenen – von der Basis bis zur globalen Ebene – erforderlich ist, um die Verschlechterung aufzuhalten.
Pedro Maria Herrera Calvo, Hauptautor des Berichts: „Die sinnvolle Beteiligung aller Interessengruppen ist der Schlüssel zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung von Weideland, die kollektives Handeln fördert, den Zugang zu Land verbessert und traditionelles Wissen und praktische Fähigkeiten einbezieht“.
Die Lösungen müssen auf die stark variierenden Merkmale und die Dynamik der Weidegebiete zugeschnitten sein. Darüber hinaus fordert der Bericht, dass Hirt:innen ihren Erfahrungsschatz aktiv einbringen und einbezogen werden, von der Planung über die Entscheidungsfindung bis hin zur Verwaltung. Häufig, so der Bericht, unterschätzen herkömmliche Bewertungsmethoden den tatsächlichen wirtschaftlichen Beitrag von Weideland und Hirtentum.
Die wichtigsten Empfehlungen:
- Strategien zur Klimawandelabschwächung und -Anpassung und nachhaltige Bewirtschaftung von Weideland integrieren, um die CO2 Bindung und Speicherung zu erhöhen und die Widerstandsfähigkeit von Hirten- und Weidelandgemeinschaften zu stärken
- Vermeidung oder Verringerung von Landnutzungsänderungen, die die Diversität und Multifunktionalität von Weideland beeinträchtigen, insbesondere auf indigenem und kommunalem Land
- Maßnahmen zur Erhaltung von Weideland innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten, um die Biodiversität über und unter der Erde zu fördern und die Gesundheit, Produktivität und Widerstandsfähigkeit extensiver Viehhaltungssysteme zu stärken
- Strategien und Praktiken stärken, die auf der Weidewirtschaft basieren und dazu beitragen, Schäden für die Gesundheit der Weideflächen, wie Klimawandel, Überweidung, Bodenerosion, invasive Arten, Dürre und Waldbrände, zu mindern
- Förderung einer unterstützenden Politik, einer umfassenden Beteiligung der Bevölkerung und flexibler Verwaltungs- und Governance-Systeme, um die Leistungen von Weideland und Hirtentum für die gesamte Gesellschaft zu stärken.
Der vollständige Bericht hier zum Downloade (Englisch): https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/glo-rangelands-report
Titelbild: Wüste Gobi, Mongolei, HBieser über Pixabay