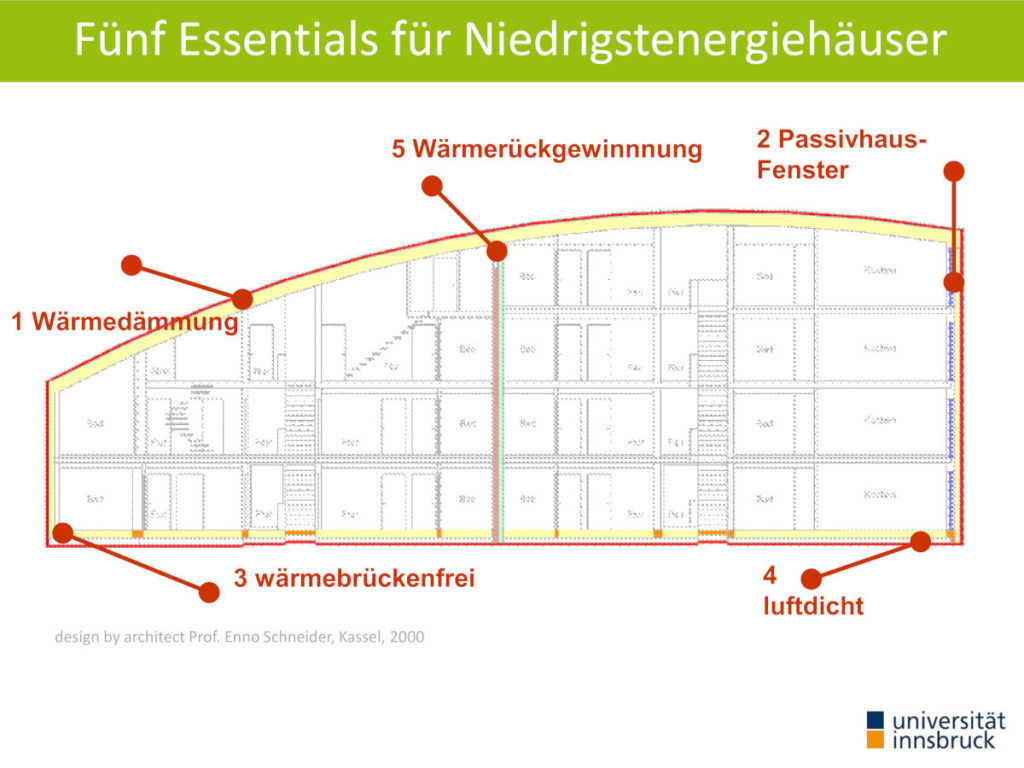Nach langem Tauziehen hat der „Inflation Reduction Act“ der Biden-Administration am 7. August 2022 den US-Senat passiert. Entgegengestellt hatte sich dem Plan vor allem der demokratische Senator Joe Manchin, Gründer des Unternehmens Enersystems, Inc., das im Bereich Kohlebergbau und Kohleverstromung tätig ist. Da die Demokraten auf seine Stimme unbedingt angewiesen waren, konnte er eine Reihe von Verwässerungen durchsetzen. Vor allem konnte er erreichen, dass neue Bohrrechte für Öl und Gas auf der Bundesregierung unterstehenden Gebieten im Golf von Mexiko und in Alaska vergeben werden1.
Dieses Gesetz soll einerseits neue Steuereinnahmen in Höhe von 739 Mrd. USD bringen, andererseits Ausgaben in Höhe von 370 Mrd. USD für die Bekämpfung des Klimawandels und die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit bewilligen. Der Rest soll der Verringerung des Budgetdefizits dienen. Eine vorläufige Analyse durch das REPEAT-Projekt (Rapid Energy Policy Evaluation and Analysis Toolkit) der Princeton-Universität2 gibt eine positive Einschätzung der Klimawirkungen, auch wenn das Gesetz hinter den Erfordernissen des Netto-Null-Plans der Biden-Administration noch weit zurückbleibt.
Laut Hauptautor Jesse Jenkins von der Princeton University würde das Gesetz die Senkung der US-Emissionen bis 2030 um ca. 42 Prozent im Vergleich zu 2005 bringen und so bis zwei Drittel der Arbeit erledigen, die zur Erreichung des Netto-Null-Zieles bis 2050 notwendig ist. Indem es die Kosten für saubere Energie weiter senken würde, würde es Bundesstaaten und Städten leichter machen, eigene Klimamaßnahmen zu setzen und so zur Schließung der Emissionslücke beizutragen3.
Der Inflation Reduction Act würde laut der Studie im Vergleich zum gegenwärtigen Pfad die jährlichen Emissionen der USA bis 2030 um eine Milliarde Tonnen reduzieren. Dadurch würde er zwei Drittel der Emissionslücke zwischen der gegenwärtigen Politik und dem Ziel der Halbierung der Emissionen bis 2030 schließen. Die USA wären damit immer noch eine halbe Milliarde Tonnen CO2e von ihrem Klimaziel entfernt, der Halbierung der Emissionen bis 2030 (im Vergleich zu 2005).
Die Reduktion der Emissionen soll vor allem durch beschleunigten Ausbau sauberer Elektrizität und die Förderung der Elektromobilität geschehen. Dadurch sollen jeweils 360 Millionen und 280 Millionen Tonnen CO2e eingespart werden. Das Gesetz bietet auch steuerliche Anreize für Investitionen in Energieeffizienz und CO2-Sequestriereung in der Industrie, was weitere 130 Millionen Tonnen einsparen soll. Laut Jenkins soll dadurch in den Industrien mit den höchsten Emissionen wie Stahl- und Zementproduktion und Raffinerien das Einfangen und Speichern des bei den Prozessen entstehenden CO2 praktikabel werden.
Steuernachlässe, Steuergutschriften und Subventionen sollen die Elektrifizierung und Energieeffizienz von Gebäuden fördern. Die Reduktion von Methanemissionen im Öl- und Gassektor soll durch eine Methangebühr aber auch durch Subventionen erreicht werden. Schutzmaßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft und Maßnahmen zur natürlichen Kohlenstoffspeicherung werden ebenfalls gefördert.
Durch das Gesetz sollen die Energiekosten in den USA bis 2030 um 4% sinken. Elektrische und Null-Emissions-Fahrzeuge sowie Wärmepumpen und Investitionen in Energieeffizienz sollen sowohl für Unternehmen wie für Haushalte billiger werden. Verringerter Verbrauch von Ölprodukten und Erdgas sollen die Rohölpreise um 5% und die Erdgaspreise um 10 bis 20% senken. Das Wachstum der Kapazität von Windanlagen könnte sich verdoppeln und das von Solaranlagen verfünffachen.
Die Studie veranschlagt, dass der Inflation Reduction Act im nächsten Jahrzehnt Investitionen im Wert von 3.500 Mrd USD in neue Energieinfrastruktur anstoßen wird, vor allem in Windkraft- und Solaranlagen, aber auch in die Produktion von Wasserstoff und in die Bereitstellung von Komponenten für saubere Energie wie Batterien oder die Gewinnung und Verarbeitung kritische Minerale.
Ein Paket von 60 Mrd. USD soll Klimagerechtigkeit fördern. Dazu gehören Programme zur Reduktion der Luftverschmutzung in einkommensschwachen Gebieten, Ersetzung von schmutzigen Schwerfahrzeugen wie Müllabfuhr oder Stadtbussen durch Null-Emissions-Fahrzeuge und die Verbesserung der Raumluft in Schulen in einkommensschwachen Gebieten. Ein Fonds von 27 Mrd USD soll benachteiligten Communities Zugang zu sauberer Energie bringen.
Der Report macht keine Erwähnung von möglichen Rebound-Effekten, also durch verbilligte saubere Energie verursachten höheren Verbrauch an Energie und Rohstoffen.
In der Einleitung wird betont, dass alle Ergebnisse vorläufige Schätzungen sind und durch weitere Studien aktualisiert werden können.
Gesichtet: Markus Palzer-Khomenko
Titelfoto: Bosox4duke via Wikipedia, CC BY-SA
1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-28/manchin-deal-mandates-oil-and-gas-lease-sales-in-gulf-and-alaska
2 Jenkins, J.D., Mayfield, E.N., Farbes, J., Jones, R., Patankar, N., Xu, Q., Schivley, G., “Preliminary Report: The Climate and Energy Impacts of the Inflation Reduction Act of 2022 ,” REPEAT Project, Princeton, NJ, August 2022. Online: https://repeatproject.org/docs/REPEAT_IRA_Prelminary_Report_2022-08-04.pdf
3 https://governorswindenergycoalition.org/how-the-new-climate-bill-would-reduce-emissions/
Folge uns:
Teile das: