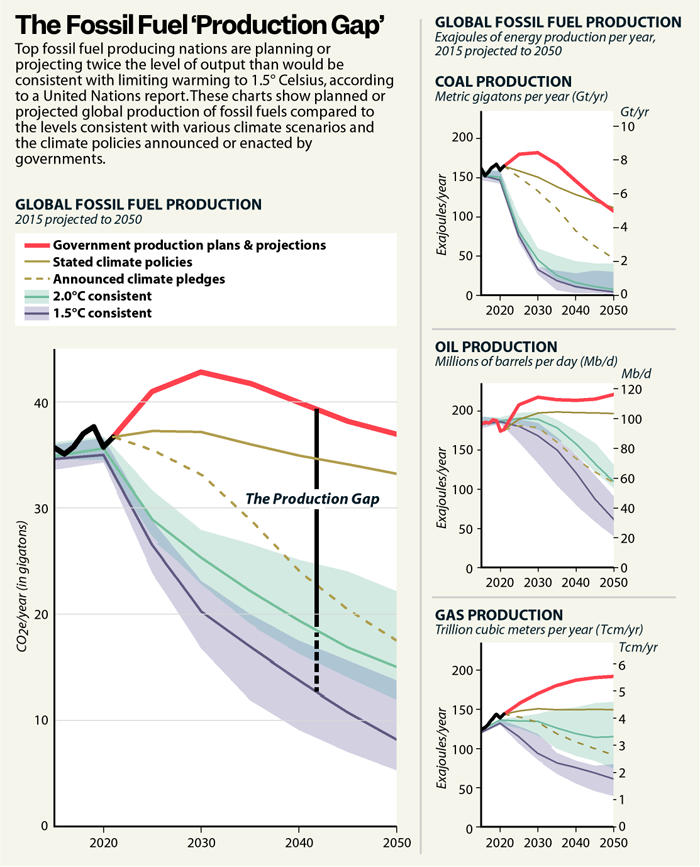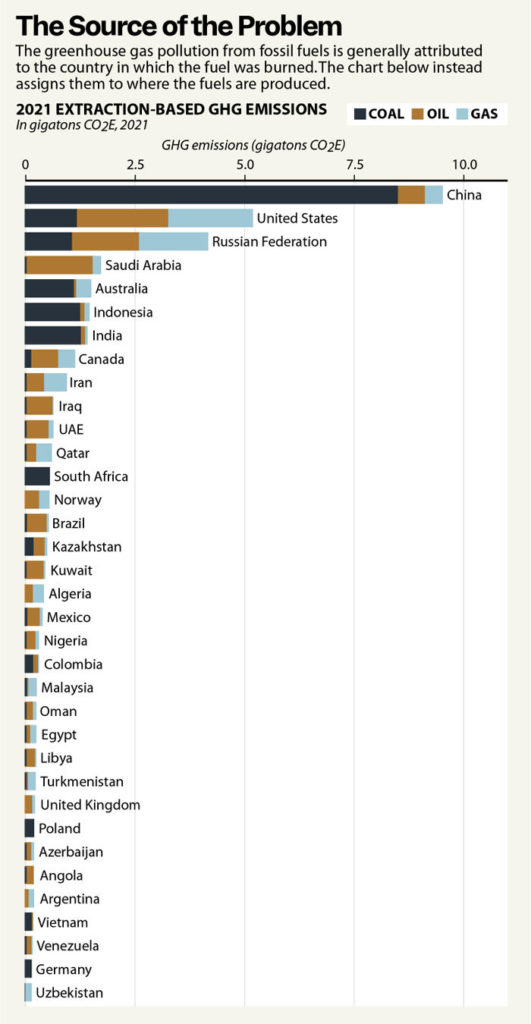Die Ökonomin Elinor Ostrom hat gezeigt, dass selbstorganisierte Gruppen sehr wohl imstand sind, gemeinschaftliche Güter nachhaltig zu bewirtschaften – entgegen der pessimistischen Theorie von der „Tragödie der Commons“. Aber geht es hier nur um traditionelle Dorfgemeinschaften?
Die Welt der Commons ist reich und vielfältig, aber es ist oft unsere Erziehung, die uns den Blick dafür verstellt. Wir werden nämlich nicht als Egoisten geboren. Es sind die Verhältnisse, die wir als selbstverständlich erachten, die aus ursprünglich kooperationsbereiten sozialen Wesen den „homo oeconomicus“, den „rationalen Nutzenmaximierer“ machen. In einem Experiment1 mit 20 Monate alten Kindern ließ der Experimentator einen Löffel fallen und bemühte sich vergeblich, ihn mit der Hand zu erreichen. Die meisten Kinder erkannten seine Not und brachten ihm den Löffel. Das taten sie auch dann immer wieder, wenn er sich nicht einmal bedankte. Doch wenn er sie mit einer Süßigkeit belohnte, und die Belohnung nach ein paar Wiederholungen plötzlich ausblieb, verloren die meisten Kinder ihre Hilfsbereitschaft. Doch die Bereitschaft zur Kooperation ist nicht gleichbedeutend mit selbstverleugnendem Altrusimus. Commoners können durchaus Nutzenmaximierer sein, nämlich des gemeinschaftlichen Nutzens.
Das bekannteste Beispiel für ein funktionierendes Commons ist Wikipedia. Hier kann jede und jeder Wissen teilen und Wissen schöpfen. Diese Wissens-Allmende wird von den User:innen selbst verwaltet. Aus anarchischen Anfängen hat sich ein komplexes System von Checks und Balances entwickelt, das die Übernahme durch Trolle und andere Trittbrettfahrer:innen weitgehend abwehren kann. Sieht man sich zentral verwaltete Plattformen wie X oder Facebook an, sieht man, wie hoch dieser Erfolg einzuschätzen ist.
Auch das Computer-Betriebssystem Linux ist aus der Commons-Idee heraus entstanden. Jede und jeder kann es nutzen, und jede und jeder darf es verbessern, abwandeln, den eigenen Bedürfnissen anpassen. Alle Open Source Software orientiert sich am Commons-Prinzip. Aber es gibt auch Open Source Hardware – also frei nutzbare, patentfreie Konstruktionspläne vom Sessel bis zum Passivhaus.
Das Mietshäuser Syndikat in Deutschland ist ein Zusammenschluss von 187 Gemeinschafts-Wohnprojekten. Die Projekte sind so verschiedenartig wie ihre Entstehungsgeschichte. Manche sind aus rein praktischen Erwägungen entstanden, andere mit politischen und gesellschaftsverändernden Zielsetzungen oder um Abrissplänen zuvorzukommen. Das Syndikat nützt sein Konw-how und berät neue Projekte, organisiert Direktkredite von Privaten und unterhält einen Solidarfonds. Das Syndikat bietet aber vor allem den einzelnen Hausprojekten einen Schutz vor sich selbst. Um die Häuser dauerhaft dem Immobilienmarkt zu entziehen, schließt sich jeweils ein Hausprojekt mit dem Syndikat zu einer GmbH zusammen. Dadurch erhält das Syndikat in Fragen des Verkaufs oder der Umwandlung in Eigentumswohnungen ein gleichberechtigtes Stimmrecht.
Mit Klick auf das Bild wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und es werden deren Datenschutzbestimmungen wirksam!
Omni Commons ist ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren Kollektiven in Oakland, Kalifornien: Alle Projekte hier sind für alle Menschen zugänglich und werden gemeinschaftlich geführt: naturwisenschaftliches Labor, Hackerspace, Kunstatelier, Versammlungs- und Proberäume, Druckerei, Konzert- und Theaterraum, eine Schule, in der jede/r unterrichten und jede/r lernen kann, und eine Cafeteria, die Gratisessen aus geretteten Lebensmitteln ausgibt.
Im vorigen Jahr wurde der „alternative Nobelpreis“ – korrekte Bezeichnung: „Right Livelihood Award“ – an das Kooperativen-Netzwerk Cecosesola in Venezuela vergeben. Und zwar „Für die Errichtung eines gerechten und kooperativen wirtschaftlichen Modells als einer robusten Alternative zu profitgetriebenen Ökonomien“. Cecosesola (Central de Cooperativas de Lara) ist ein Netzwerk von ländlichen und städtischen Kooperativen im Andenvorland, das über 100.000 Familien in sieben venezolanischen Bundesstaaten mit erschwinglichen Gütern und Dienstleistungen versorgt. Und das seit 55 Jahren. Die Kooperativen produzieren und vertreiben Lebensmittel, bieten Gesundheitsdienste, Transport und sogar Bestattungen an. Sie betreiben vier große Märkte in der 1,25-Millionen-Stadt Barquisimento. Die Lebensmittel werden dort zu einem einheitlichen Kilopreis verkauft – 1 kg Tomaten kostet gleich viel wie 1 kg Kartoffeln. Die einzelnen Dorfgemeinschaften beraten mit den Angestellten der Genossenschaft, welche Produktionskosten sie haben: Saatgut, Bewässerungsrohre, Treibstoff für Pumpen, Maultiere, die das Gemüse bis zu den befahrbaren Straßen bringen… Die Kosten aller Gemeinden werden zusammengelegt, ebenso die Mengen der von jedem Dorf produzierten Gemüse. Daraus ergibt sich der einheitliche Kilopreis. Unterschiedliche Produktionsbedingungen in günstigen und weniger günstigen Lagen werden so ausgeglichen, Der Einheitspreis erspart eine Menge Bürokratie, es gibt keine Kosten für Marketing und Werbung, keinen Zwischenhandel. „Unser Maßstab sind einfach die Produktionskosten inklusive dem, was die Produzierenden zum Leben brauchen“, erklärt Kooperativenmitglied Noel Vale Valera. Dadurch liegen die Preise von Cecosesola deutlich unter den üblichen Marktpreisen. Über ein halbes Jahrhundert konnte die Kooperativen-Kooperative politische und wirtschaftliche Krisen überstehen, auch eine Hyperinflation, die 1917 fast 3.000 Prozent betrug. Nachzulesen in dem Buch „Die Welt der Commons“ von Silke Helfrich und David Bollier.2
Auf der Webseite des Buchs steht in einem sternförmigen Logo:„Open Access“. Open Access ist die Umsetzung des Commons-Gedankens in der Wissenschaft. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG bietet die folgende Definition: „Open Access (englisch für offener Zugang) ist der freie Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und anderen Materialien im Internet. Ein unter Open-Access-Bedingungen publiziertes wissenschaftliches Dokument kann jede und jeder lesen, herunterladen, speichern, verlinken, drucken und damit entgeltfrei nutzen.“ In der Praxis heißt das zum Beispiel, dass man das Buch von Silke Helfrich als PDF herunterladen kann. Wissenschaftliche Journale sind teuer und die einzelnen Artikel im Internet sind meist hinter einer Bezahlschranke verborgen. Es gibt aber eben auch Open-Access-Zeitschriften, deren Beiträge genau wie die anderer Journale von unabhängigen Gutachter:innen geprüft sind (Peer-Review), aber im Internet ohne Bezahlung zugänglich sind. Aber nicht alles, was jemand als wissenschaftlich ins Internet stellt, darf sich Open Access nennen. Um die Qualität sicherzustellen gibt es das „Directory of Open Access Journals“ und das „Directory of Open Access Books“.
Nicht nur für wissenschaftliche, sondern für jegliche Art von Publikationen wurde „Creative Commons“ geschaffen. Das sind international standardisierte Lizenzen, die es den Produzent:innen ermöglichen, ihre Produkte so der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, dass sie nicht von anderen vereinnahmt werden können. So können Inhalte uneingeschränkt oder mit verschiedenen Bedingungen geteilt werden. Am häufigsten wird eine Lizenz verwendet, die die Nennung der Autor:in verlangt und dass die Weitergabe unter derselben Bedingung erfolgt. Möglich ist auch die Beschränkung auf nichtkommerzielle Nutzung oder die Bedingung, dass das Werk nicht abgewandelt werden darf.
Zurück zu handgreiflicheren Commons. Haben Sie Lust auf „Kriacherln“? In Innsbruck Ecke Andreas-Hofer-Straße und Franz-Fischer-Straße, über der Zufahrt zur Tiefgarage, steht ein schöner, frei zugänglicher Mirabellenbaum. Verzeichnet ist er, wie tausende andere Obstbäume und Beerensträucher auf öffentlichem Grund, in der Karte von mundraub.org.
Und kennen Sie den einzigen selbstverwalteten Park von Wien? Es ist der Planquadratgarten im 4. Bezirk. Wie sich die Anwohner:innen in den 1970er Jahren diesen Gemeinschaftsgarten erkämpft und den Abbruch ihrer Häuser verhindert haben, und zwar mit tatkräftiger Unterstützung durch ein Fernsehteam des ORF, das können Sie auf der Webseite des Ersten Wiener Protestwanderwegs hören und sehen.
Titelbild: Wild Woods Farm in Iowa versorgt 200 Haushalte direkt mit 30 verschiedenen Gemüsearten. Das hier ist der wöchentliche Anteil, den sich Mitglieder an einer der sieben Pick-up-Stationen abholen können.
Foto: U.S. Dept. of Agriculture – Public Domain
1 Warneken, Felix/Tomasello, Michael (2008): »Extrinsic Rewards Undermine Altruistic Tendencies in 20-Month-Olds«, in: Developmental Psychology, Vol 44 (6), S. 1785-1788.
2 Silke Helfrich, David Bollier, Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.) (2015): Die Welt der Commons. Muster gemeinsamen Handelns. Berlin, Boston, Bielefeld.
Folge uns:
Teile das: