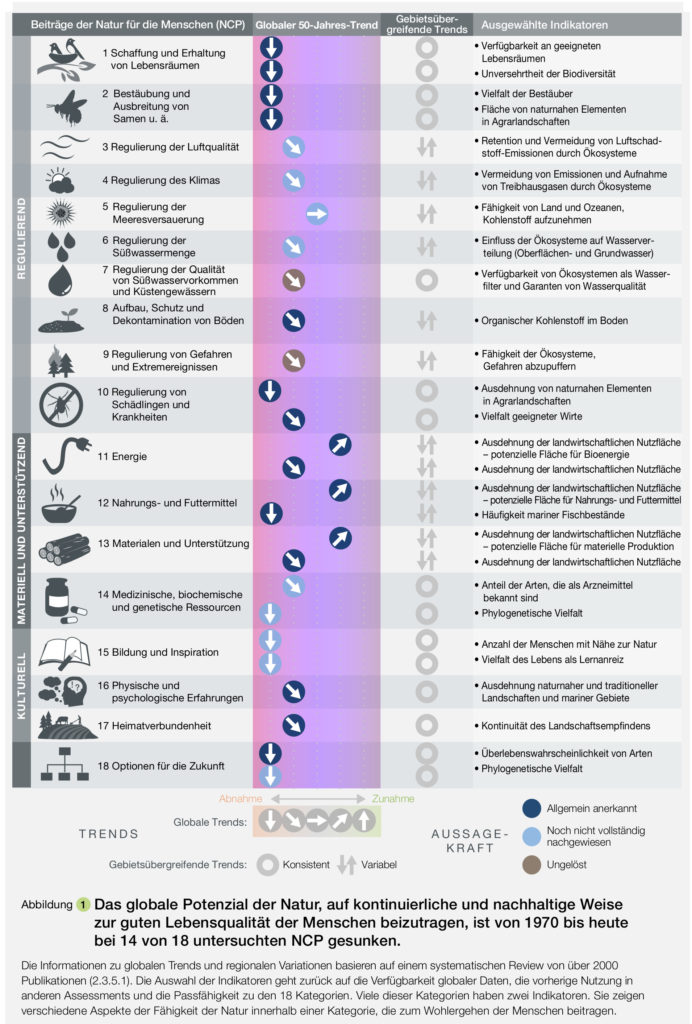175 Mitgliedsländer der Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) haben am 1. März in einer Resolution1 beschlossen, bis 2024 einen verbindlichen Vertrag zur Beendigung der Plastikverschmutzung zu schließen. Dieser Vertrag soll den kompletten Lebenszyklus von Plastik von der Produktion bis zur Entsorgung regeln. Damit hat sich laut der Zeitschrift New Scientist2 der Entwurf von Peru und Ruanda durchgesetzt, der die gesamte Kette von der Produktion über den Gebrauch bis zur Entsorgung einschließt. Ein zweiter Entwurf, für den sich vor allem Japan einsetzte, konzentrierte sich nur auf die Plastikverschmutzung der Meere. Die Resolution verlangt einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag. Sie erkennt auch an, dass Länder mit niedrigem Einkommen3 es schwerer haben, das Problem der Plastikverschmutzung zu bewältigen, und daher auch ein Finanzierungsmodell notwendig ist, das die Lasten gerechter verteilt.
„Ende der Plastikverschmutzung in Sicht? Internationales Abkommen beschlossenvon Martin Auer“ weiterlesenFolge uns:

Teile das: