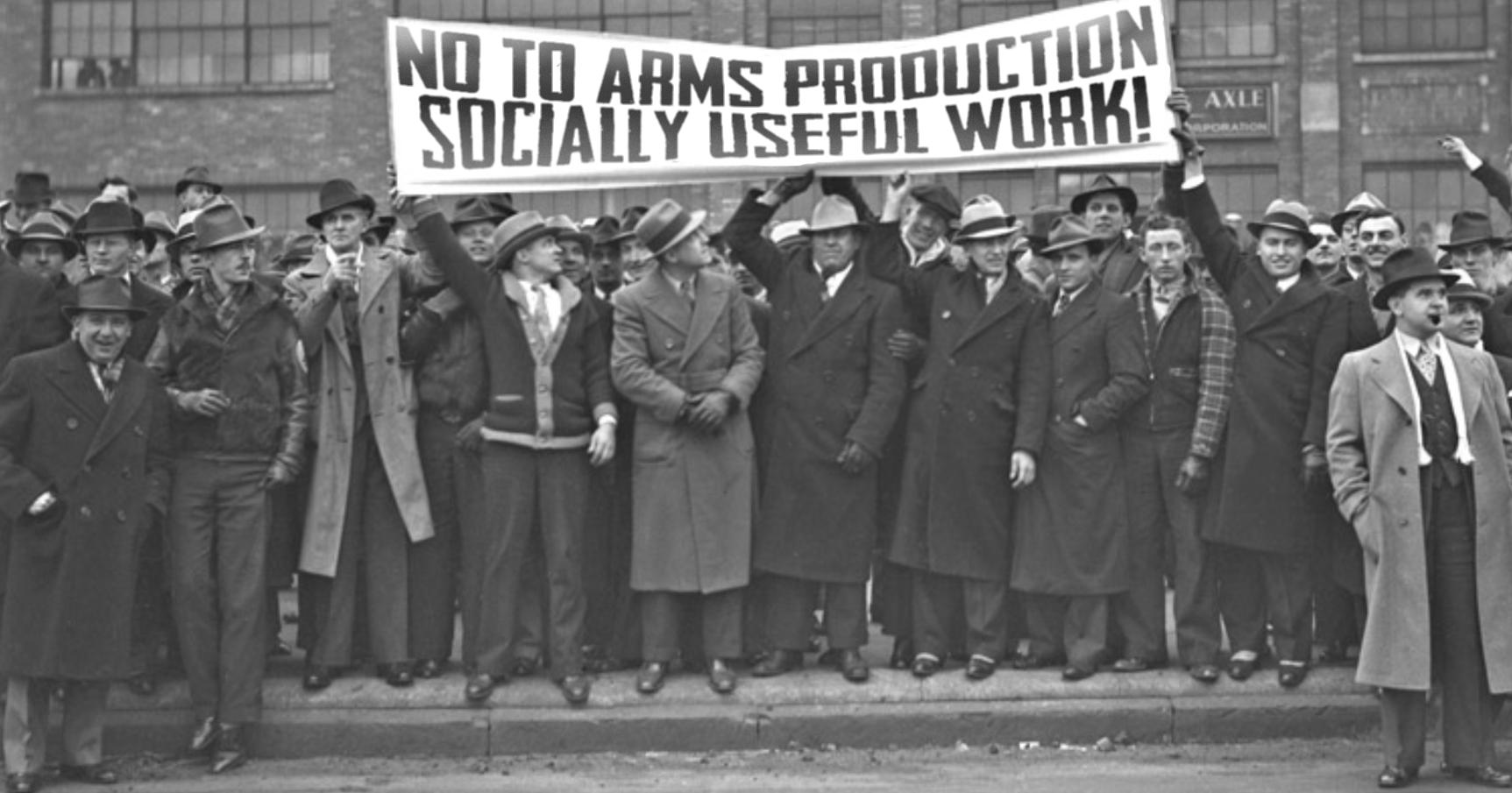In einer Kurzstudie haben Benjamin Neimark von der Queen Mary University of London und vier Kolleg:innen die klimatechnischen Auswirkungen der ersten 60 Tage des Kriegs zwischen Israel und Hamas errechnet. Die CO2-Emissionen in diesem Zeitraum waren so hoch wie die der 20 durch die Klimaerhitzung verwundbarsten Länder. Über 99 % dieser 281.000 Tonnen CO2 (entspricht etwa dem Verbrennen von 150.000 Tonnen Kohle) wurden durch die Bombardierung des Gaza-Streifens und die Bodenoffensive der israelischen Armee verursacht. Einbezogen wurden Emissionen vom Treibstoff für Flugzeuge, Panzer und andere Fahrzeuge, und die Emissionen durch die Herstellung und das Explodieren von Bomben, Artilleriegeschossen und Raketen. Andere Treibhausgase wie zum Beispiel Methan wurden in die Studie nicht einbezogen. Fast die Hälfte der CO2-Emissionen wurde durch die US-amerikanischen Flugzeuge verursacht, die militärischen Nachschub nach Israel brachten.
Die Raketen, die von der Hamas auf Israel abgefeuert wurden, verursachten ungefähr 713 Tonnen CO2 (entspricht 300 Tonnen verbrannter Kohle).
36 bis 45 % aller Gebäude in Gaza sind zerstört worden. Der Wiederaufbau dieser 100.000 Gebäude in Gaza wird mindestens 30 Millionen Tonnen CO2 verursachen. Das entspricht den jährlichen Emissionen von Neuseeland.
Generell verursachen die Militärs der Welt 5,5 % der globalen Emissionen, mehr als die zivile Luftfahrt und die Schifffahrt zusammengenommen. Beim Klimagipfel COP28 in Dubai standen die Zusammenhänge zwischen Krieg, Sicherheit und der Klimakatastrophe zwar auf der Agenda, doch das führte nicht zu irgendwelchen wirksamen Schritten, um die Militärs in die Verantwortung zu nehmen und mehr Transparenz zu erreichen.